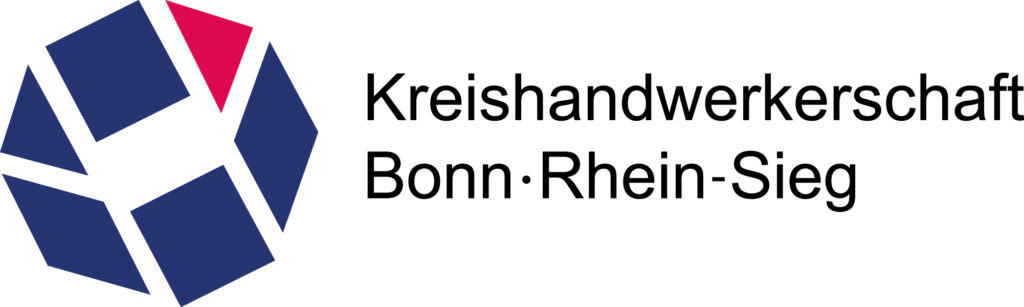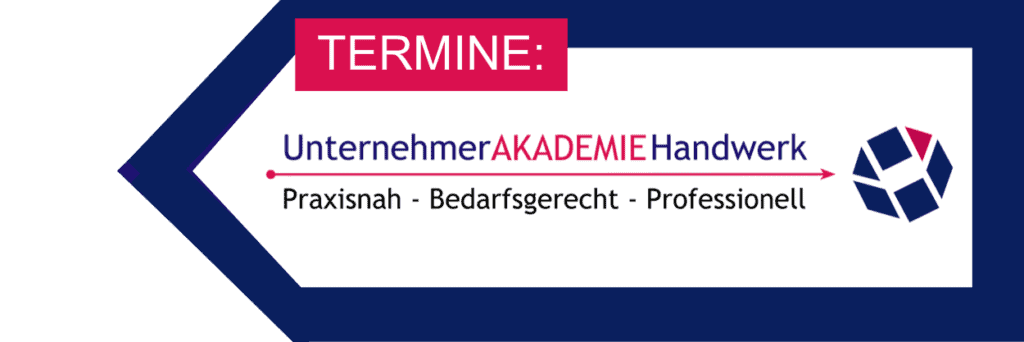Kategorie: Aktuelles

A565: Wieder Vollsperrungen zwischen Anschlussstelle Bonn-Endenich und Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf im Januar.
Closeup focus shot of a construction sign barrier on the sidewalkby wirestock @envato.elements.com Bonn (Autobahn GmbH). Von Freitag (16.1.26), 20 Uhr, bis Samstag (31.1.26), 20 Uhr, ist die A565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf und der Anschlussstelle Bonn-Endenich in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Köln an der Anschlussstelle Bonn-Endenich bleibt von der Sperrung im gesamten Zeitraum unbetroffen. Die Sperrung der entgegengesetzten Fahrtrichtung Meckenheim erfolgt von Samstag (31.1.26), 21 Uhr, bis Mittwoch (11.2.26), 5 Uhr. Die Ausfahrt Bonn-Poppelsdorf bleibt in diesem Zeitraum geöffnet. Die Vollsperrung ist für den Aufbau eines Traggerüstes notwendig und wird über mobile Anzeigen lokal vorangekündigt. Die B56 am „Endenicher Ei“ ist von der Vollsperrung nicht betroffen und bleibt durchgängig geöffnet. Empfohlene Umleitungen Das großräumige Umleitungskonzept zur Sperrung des betroffenen Teilstückes der A565 sieht von Süden kommend eine Umleitung des Verkehrs in Richtung Köln und Bornheim ab dem Kreuz Meckenheim (12) über die A61 und A553 auf die A555 vor. Die innerörtliche, ausgeschilderte Umleitung führt auf der A565 von Süden kommend ab der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg (9) über den Konrad-Adenauer-Damm (L113), die Kreisstraße K12 und die Landesstraße 183n zur Anschlussstelle Bornheim (6) der A555. Dies gilt auch in entgegengesetzter Richtung für den Verkehr, der über die A555 von Norden aus Köln kommt. Die Autobahn GmbH Rheinland arbeitet seit Oktober 2023 am Brückenbauwerk „Endenicher Ei“ im Verlauf der B56 über der A565. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant. Quelle:https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a565-vollsperrung-zwischen-anschlussstelle-bonn-poppelsdorf-und-bonn-endenich

Baustellenhinweis: HBZ Siegburg – Arbeiten an der Kreuzung Frankfurter Straße / Wahnbachtalstraße ab dem 27. Oktober 2025
Baustellenhinweis: Arbeiten an der Kreuzung Frankfurter Straße / Wahnbachtalstraße ab dem 27. Oktober 2025 Ab dem 27. Oktober 2025 beginnen Bauarbeiten an der Kreuzung Frankfurter Straße / Wahnbachtalstraße.Aufgrund der Maßnahme ist in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen, Staus und Verzögerungen bei der Anfahrt zum HBZ zu rechnen. Wir bitten alle ÜBL-Lehrlinge und Prüflinge, dies bei der Planung ihrer Anreise zu berücksichtigen. Nutzen Sie nach Möglichkeit Ausweichrouten über die Wilhelm-Ostwald-Straße – Dammstraße – Wahnbachtalstraße oder planen Sie ausreichend zusätzliche Fahrzeit ein. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Tag des Handwerks 2025: Handwerk feiert in Bad Honnef
Tag des Handwerks 2025: Handwerk feiert in Bad Honnef Die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg feierte am Freitag, den 19. September 2025, im Kurhaus Bad Honnef den diesjährigen „Tag des Handwerks“. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handwerk waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam die Bedeutung des Handwerks für die Region zu würdigen und herausragende Persönlichkeiten sowie Betriebe auszuzeichnen. Kreishandwerksmeister Michael Christmann eröffnete die Veranstaltung und freute sich, Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), als Ehrengast begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit Dittrich und Handwerkskammerpräsident Thomas Radermacher diskutierte er unter dem Titel „Quo vadis Handwerk?“ über die Zukunftsperspektiven des Handwerks und aktuelle Herausforderungen. Einer der Höhepunkte des Abends war die Ehrung von Thomas Radermacher selbst, der noch bis Mai das Amt des Kreishandwerksmeisters in Bonn/Rhein-Sieg bekleidete. ZDH-Präsident Dittrich zeichnete Radermacher für sein langjähriges Engagement und seine Verdienste um das Handwerk mit dem Handwerkszeichen in Gold, der höchsten Auszeichnung des ZDH, aus. Für unterhaltsame Momente sorgte anschließend Comedian Benni Stark, der das Publikum mit seinem Programm „Schon lustig, wenn’s witzig ist“ begeisterte. Handwerkskammerpräsident Thomas Radermacher erhält von ZDH Präsident Dittrich das Handwerkszeichen in Gold. Michael Christmann – Kreishandwerksmeister Im Mittelpunkt stand traditionell die Verleihung des Titels „Handwerksbetrieb des Jahres 2025“, die in diesem Jahr an das Autohaus Wexeler aus Bornheim verliehen wurde. Der Betrieb besteht in dritter Generation. Die Besonderheit: Drei Kinder der dritten Generation haben sich ihrem Familienunternehmen verpflichtet und leiten das Autohaus gemeinsam. Die Auszeichnung in der Kategorie „Vorbildliche Kooperation“ erhielt das Meisterteam Bonn, ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmerinnen und Unternehmer, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Synergien zum Vorteil der Kundschaft nutzbar zu machen. In der Kategorie „Besonderes Engagement“ wurde die IKK classic, vertreten durch Sandra Calmund-Föller, für die langjährige Partnerschaft zum Handwerk in der Region ausgezeichnet. Autohaus Wexeler meisterteam Bonn IKK classic Mit besonderer Spannung erwartet wurde auch die Ehrung der besten Auszubildenden des Jahrgangs. Für ihre hervorragenden Leistungen in den Gesellen- und Abschlussprüfungen 2024 wurden ausgezeichnet: Erik Schwarz, Metallbauer bei Christian Thiesen Metallbau Hauke Johannes Hingst, Elektroniker bei VOFA Elektrotechnik GbR Lisa Tertel, Bäckereifachverkäuferin bei Bodo Penkert Maximilian Klein, Dachdecker bei Setz & Leuwer Fabian Strk, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker bei BMW AG Bonn Yannick Moll, Anlagenmechaniker bei Josef Küpper Söhne GmbH Die Preisträger erhielten neben Urkunden auch Gutscheine und Geldpreise und stehen stellvertretend für die hohe Ausbildungsleistung im Handwerk der Region. Zum Abschluss kamen alle Geehrten zu einem gemeinsamen Pressefoto zusammen. Bei einem anschließenden Imbiss nutzten die Gäste die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die Chancen und Herausforderungen der Branche auszutauschen. „Der Tag des Handwerks zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, vielfältig und zukunftsorientiert unsere Branche ist“, betonte Kreishandwerksmeister Christmann. „Das Handwerk prägt nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unser gesellschaftliches Miteinander.“ Pressetext und Bilder zum Download: Hier klicken Impressionen des Abends:

Masterplan Handwerk Bonn: Zukunftsaufgaben gemeinschaftlich lösen
Bild:Sascha Engst/Bundesstadt Bonn Vertragsunterzeichnung des Masterplans Handwerk Bonn: Oberbürgermeister Katja Dörner und Thomas Radermacher, Präsident der Handwerkskammer (HWK) zu Köln bei der Unterschrift. Ebenfalls unterzeichneten (hinten von links) Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe, Oliver Krämer und Michael Christmann, Kreishandwerkermeister und Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, sowie HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Erik Werdel. Die gemeinsame Initiative der Bundesstadt Bonn, der Handwerkskammer zu Köln und der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg zur Förderung und Unterstützung des Bonner Handwerks entwickelt die vor fünf Jahren unterzeichnete „Mittelstandsinitiative“ weiter. Gemeinsame Unterzeichnung im Alten Rathaus. Große Herausforderungen lassen sich gemeinschaftlich besser meistern. Daher setzen die Stadt Bonn, die Handwerkskammer zu Köln und die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg erneut ein Zeichen für eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Im Alten Rathaus unterzeichneten am Montag, 30. Juni 2025, Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe, für die Handwerkskammer zu Köln Präsident Thomas Radermacher und Hauptgeschäftsführer Dr. Erik Werdel sowie für die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg Kreishandwerksmeister Michael Christmann und Hauptgeschäftsführer Oliver Krämer den Masterplan Handwerk Bonn. Diese gemeinsame Initiative soll dabei unterstützen, anstehende Zukunftsaufgaben wie Mobilitätswende, Umgang mit der Klimakrise und Stadtumbau gemeinschaftlich zu lösen. Der Masterplan Handwerk ist zudem ein deutliches Zeichen für die hohe Bedeutung des Handwerks als Wirtschaftsfaktor in und für Bonn. „Das Handwerk mit seiner klein- und mittelbetrieblichen Struktur bildet einen wichtigen Bestandteil der Bonner Wirtschaft, es bietet Arbeits- und Ausbildungsplätze und hat neben dem produzierenden Gewerbe einen hohen Stellenwert im dienstleistungsgeprägten Bonn“, betonte Oberbürgermeisterin Katja Dörner bei der Vertragsunterzeichnung. „Das Handwerk leistet auch einen großen Beitrag auf dem Weg zur Erreichung des Bonner Klimaziels – als Dienstleister für innovative und nachhaltige Technologien, aber auch als eigener Akteur. Daher freue ich mich, dass wir mit dem Masterplan Handwerk unsere vor fünf Jahren schon besiegelte Zusammenarbeit weiterentwickeln“, so die OB weiter. Der Masterplan Handwerk Bonn ist die Neuauflage der im Jahr 2020 unterzeichneten „Initiative zur Förderung des Mittelstands“, der zusätzlich jetzt auch von der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg unterzeichnet wird. Thomas Radermacher, Präsident der Handwerkskammer zu Köln, sagte: „Der neue Masterplan Handwerk ist ein gutes Werkzeug, um unsere Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn in den wichtigsten Bereichen zu klären und voranzutreiben. Er dient als verbindliche Grundlage, um konkrete Fortschritte für unsere Betriebe bei Themen wie Bürokratieabbau und Vergabeverfahren zu erzielen und die Mobilität des Handwerks zu gewährleisten. Im Austausch mit der Stadt haben wir – beispielsweise mit den Wirtschaftsparkplätzen – schon viele Lösungen erarbeitet. Der Masterplan zeigt auf, wo noch Luft nach oben ist – an diesen Stellen werden wir uns weiterhin konsequent für Verbesserungen einsetzen.“ Kreishandwerksmeister Michael Christmann ergänzte: „Mit dem Masterplan Handwerk wird das Handwerk in Bonn als das anerkannt, was es ist: Ein wichtiger Motor für Ausbildung, Beschäftigung und Innovation. Damit dieser Motor rund läuft, braucht das Handwerk gute Rahmenbedingungen, unter anderem ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren und gut angebundenen Flächen. Anhand des Masterplans können wir mit der Stadt regelmäßig überprüfen, wie gut die Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele zur Unterstützung des Handwerks vorangeht. Wir freuen uns, dass die Kreishandwerkerschaft nun Teil der Initiative ist und diesen Weg aktiv mitgestaltet.“ Im Masterplan Handwerk sind sieben Themenfelder definiert: Gewerbeflächen, Mobilität, Fachkräfte, Vergabepraxis, Bürokratieabbau, Klimaschutz und Energie- und Wärmewende sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Handwerk. Viele Punkte, die im Masterplan aufgeführt werden, werden bei der Stadt Bonn bereits seit geraumer Zeit umgesetzt bzw. sind konkret in der Planung. Für den weiteren Austausch und auch, um Fortschritte messbar zu machen, werden sich die Stadt Bonn und die Partner jedes Jahr zu Spitzengesprächen treffen. Nach einer Laufzeit von fünf Jahren werden die Zwischenergebnisse evaluiert und die Vereinbarung aktualisiert. Masterplan-Bonn-PDF

EU-Online-Streitbeilegungsplattform eingestellt – Was Betriebe jetzt tun müssen
Bild von fotodestock @Elements.envato Die Europäische Kommission stellt die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) zum 20. Juli 2025 endgültig ein. Damit entfällt ab diesem Zeitpunkt die gesetzliche Verpflichtung, auf die Plattform hinzuweisen. Zur Erinnerung: Was war die OS-Plattform? Die OS-Plattform sollte eine zentrale Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmen zur einfachen, kostengünstigen und außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten für online abgeschlossene Verträge über Waren und Dienstleistungen bieten. Viele Betriebe waren seit Anfang 2016 verpflichtet, auf ihrer Website und in bestimmten Dokumenten (z. B. AGB oder Impressum) einen entsprechenden Link zur Plattform bereitzustellen. Da dieses Streitbeilegungsverfahren in der Praxis jedoch kaum genutzt wurde, hatte die Europäische Kommission entschieden, die Plattform einzustellen. Bereits seit dem 20.03.2025 konnten dort keine Beschwerden mehr eingereicht werden. Was bedeutet das für die Mitgliedsbetriebe in der Praxis? Mit der Einstellung der Plattform entfällt auch die Hinweispflicht nach der EU-Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten. In der Praxis heißt das: Alle Hinweise auf die OS-Plattform müssen bis zum 20. Juli 2025 entfernt werden, insbesondere: der Link zur Plattform (https://ec.europa.eu/consumers/odr)Begleittexte wie „Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten…“Hinweise in den AGB, im Impressum oder in E-Mail-Signaturen Empfehlung Jeder Betroffene, der die Informationen zur Online-Streitbeilegungsplattform auf seiner Webseite etc. mit aufgenommen hatte, sollte nun seine Website, allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), das Impressum sowie alle weiteren Texte und Vorlagen prüfen, ob dort noch Hinweise auf die OS-Plattform enthalten sind – und diese dann umgehend entfernen. Hintergrund ist, dass es als irreführend angesehen werden könnte, Verbraucher zum Zwecke der Nutzung einer angeblichen Streitbeilegungsmöglichkeit auf die – dann gar nicht mehr existente – OS-Plattform zu verweisen. Dies könnte zu Abmahnungen führen. Quelle: https://www.hwk-koeln.de/artikel/eu-online-streitbeilegungsplattform-eingestellt-was-betriebe-jetzt-tun-muessen-32,0,3086.html

Michael Christmann zum neuen Kreishandwerksmeister gewählt –Thomas Radermacher verabschiedet
v.l. Oliver Krämer, Thomas Radermacher und Michael Christmann. Die Kreishandwerkerschaft Bonn·Rhein-Sieg hat einen neuen Kreishandwerksmeister: In der gestrigen Mitgliederversammlung wurde Stuckateurmeister Michael Christmann, Inhaber der Firma Stuck Belz aus Bonn, einstimmig in das Amt gewählt. Christmann bringt langjährige Erfahrung aus der Tätigkeit in den Vorständen der Stuckateur-Innung sowie der Kreishandwerkerschaft mit. Er ist dem Handwerk eng verbunden und betonte nach seiner Wahl: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder und werde mich mit vollem Einsatz für die Stärkung des Handwerks und die Interessen der Betriebe einsetzen.“ Auch die Geschäftsführung zeigt sich überzeugt vom neuen Kreishandwerksmeister. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Christmann und bin sicher, dass er die Aufgaben mit Engagement und Fachkompetenz meistern wird“, sagte Oliver Krämer, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Gemeinsam möchten wir die Herausforderungen der Zukunft angehen und die Handwerksbetriebe in unserer Region weiterhin erfolgreich unterstützen.“ Im Rahmen der Versammlung wurde zugleich Thomas Radermacher feierlich verabschiedet. Nach mehr als 17jähriger Tätigkeit als Kreishandwerksmeister konnte er dieses Ehrenamt aufgrund seiner Wahl zum Präsidenten der Handwerkskammer zu Köln nicht weiterführen. Vorstand und Geschäftsführung dankten ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und seine verdienstvolle Arbeit. Als Zeichen besonderer Anerkennung wurde Radermacher zum Ehrenkreishandwerksmeister gewählt. Pressemitteilung – PDF

Vollversammlung wählt Meckenheimer Tischlermeister Thomas Radermacher einstimmig zum neuen Präsidenten der Handwerkskammer zu Köln
v.l. Hans Peter Wollseifer, Thomas Radermacher – Foto: Mark Hermenau Die Handwerkskammer zu Köln hat eine neue Vollversammlung. Deren 54 Mitglieder wählten in ihrer konstituierenden Sitzung Thomas Radermacher zum neuen Präsidenten. Er folgt auf Hans Peter Wollseifer, der nach 15 Jahren als HWK-Präsident nicht erneut zur Wahl antrat. Die neue Vollversammlung der Handwerkskammer zu Köln hat am Donnerstag (22. Mai) Thomas Radermacher (64) einstimmig für fünf Jahre an die Spitze der Kammer gewählt. Der Tischlermeister betreibt eine Schreinerei in Meckenheim, gehört seit 15 Jahren dem Vorstand der HWK Köln an und ist seit sieben Jahren Präsident des Bundesverbands Tischler Schreiner Deutschland. In den vergangenen 18 Jahren war er zudem Kreishandwerksmeister für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis; da laut Satzung der HWK der Präsident nicht gleichzeitig Kreishandwerksmeister sein darf, gibt Radermacher dieses Amt auf. Als Vizepräsidenten bestätigte die Vollversammlung für die Arbeitgeberseite Rüdiger Otto und für die Arbeitnehmerseite Alexander Hengst. Gewählt wurden auch neun Beisitzer/innen für den Vorstand der Kammer sowie die Mitglieder der Kammer-Ausschüsse. Die Vollversammlung selbst war bereits im Frühjahr gewählt worden und kam nun zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dem für fünf Jahre gewählten höchsten Kammer-Organ gehören 54 ehrenamtliche Mitglieder an – 36 selbstständige Handwerkerinnen und Handwerker sowie 18 Mitglieder für die Arbeitnehmerseite. Wahlleiter für die Wahl zur Vollversammlung war Regierungspräsident Dr. Thomas Wilk, der ein Grußwort hielt. Präsident Thomas Radermacher dankte der Vollversammlung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Als Präsident der Handwerkskammer zu Köln möchte ich gerne das Gesicht und die Stimme unserer großartigen Branche in dieser Region und darüber hinaus sein. Uns als Handwerkskammer muss es gelingen, den Handwerkerinnen und Handwerkern noch besser zu vermitteln, dass wir ihre fachliche und politische Vertretung sind. Wir sind Dienstleister und setzen uns für alle Menschen im Handwerk ein, ob auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite. Es ist mir sehr wichtig, dass wir die gute Zusammenarbeit mit den Kreishandwerkerschaften sowie den selbstständigen Innungen auf Augenhöhe und partnerschaftlich fortführen.“ Radermacher kündigte an, sein neues Amt mit Einsatz, Begeisterung und Authentizität auszuüben und dabei Tacheles zu reden: „Ich werde mich für Sie und für uns alle nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen, um die berechtigten Interessen des Handwerks nicht nur zu postulieren, sondern auch um ihre Durchsetzung zu kämpfen. Unsere Branche braucht und verdient mehr öffentliche Anerkennung und Wahrnehmung. Wir brauchen die Anerkennung der Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung.“ Als zentrale Herausforderungen nannte Radermacher den Mangel an Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften im Handwerk sowie die Klima- und die Verkehrswende. Letztere gelinge nur mit dem Handwerk und müsse von der Politik klug und mit Augenmaß angegangen werden. In seinem letzten Bericht als Präsident dankte Hans Peter Wollseifer seinen Kolleginnen und Kollegen für ihr ehrenamtliches Engagement für das Handwerk. Er ging auch auf die politische und wirtschaftliche Lage im Land ein: „Es braucht in Deutschland die Erkenntnis, dass es wichtig ist, die Millionen mittelständischen Unternehmen zu unterstützen und mit guten Standortbedingungen zu fördern. Unsere Handwerksbetriebe werden durch hohe Lohnnebenkosten belastet und sind gezwungen, steigende Material-, Energie- und Bürokratiekosten an ihre Kundschaft weiterzugeben. Wenn handwerkliche Dienstleistungen zur Luxusware werden, droht ein gesellschaftlicher Wohlstandsverlust. Nur eine florierende Wirtschaft garantiert hohe Beschäftigung, sichere Arbeitsplätze und gute Staatserträge – und damit die Grundlage für dauerhaft gute Sozialleistungen im Land. Der Slogan der neuen Bundesregierung sollte lauten: ‚Nichts ist unmöglich, packen wir’s an!’“ Nach 30 Jahren im Vorstand, fünf Jahren als Vizepräsident und 15 Jahren als Präsident der HWK Köln sowie neun Jahren als Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (2014-2022) sagte Wollseifer: „Die Zeit an der Spitze des Ehrenamts in der Region hat mir viel gegeben. Nichts ist für immer – alles hat seine Zeit. Deshalb schließe ich ab, mit dem was war, bin glücklich mit dem, was ist, und freue mich auf das, was kommt.“ Hans Peter Wollseifer neuer Ehrenpräsident der Handwerkskammer zu KölnFreuen durfte sich Wollseifer über einen Beschluss der Vollversammlung, wonach er neuer Ehrenpräsident ist. Radermacher würdigte Wollseifers „außergewöhnlichen Einsatz und nachhaltige Arbeit für unsere gesamte Branche und unsere Region“: „Lieber Hans Peter, Du hast dem Handwerk in all den Jahren eine starke Stimme gegeben. Du warst für viele ein Vorbild, ein Impulsgeber und auch ein persönlicher Ratgeber. Du bleibst ein Teil dieser Kammer, dieser Gemeinschaft und des Handwerks. Und es ist uns eine große Ehre, Dich zum Ehrenpräsidenten der Handwerkskammer zu Köln zu ernennen.“ Auch Dr. Erik Werdel, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, richtete persönliche Worte an den scheidenden Präsidenten Hans Peter Wollseifer: „Sie haben sich unermüdlich für die Belange des Handwerks stark gemacht, auf allen Ebenen – kommunal, landes- und bundesweit. Ihre Stimme hatte Gewicht – in der Politik, in der Öffentlichkeit, bei unseren Mitgliedsbetrieben. Durch Ihren Abschied endet ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Handwerkskammer zu Köln. Danke für Ihre Dienste und die konstruktive Zusammenarbeit.“ Werdel, selbst knapp ein Jahr im Amt, stellte der Vollversammlung den gerade veröffentlichten Geschäftsbericht für 2024 vor. Dieser rückt das ehrenamtliche Engagement für das Handwerk ebenso in den Fokus wie die Dienstleistungen der Kammer für ihre Mitgliedsbetriebe und gibt einen Rückblick auf zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen der HWK Köln beispielsweise zur Nachwuchsgewinnung. Positionspapier zur Situation in den Berufskollegs verabschiedetDie neue Vollversammlung fällte gleich mehrere Beschlüsse, unter anderem zu Themen der Berufsbildung. Zudem verabschiedete die Vollversammlung ein Positionspapier der Handwerkskammer zur Situation der Berufskollegs im Kammerbezirk. Hintergrund: Zahlreiche gewerbliche Berufskollegs, gerade in Köln, aber auch an anderen Orten, haben mit maroden Gebäuden und mangelhafter Technik zu kämpfen. Der Berufsbildungsausschuss und die Vollversammlung der HWK richten vier zentrale Forderungen an die Schulträger, insbesondere die Stadt Köln, und die zuständigen politischen Gremien. Es geht um die Beschleunigung der Vergabeverfahren bei Anschaffungen und baulichen Maßnahmen, um die zügige Verbesserung von digitaler Infrastruktur und IT-Service, die Priorisierung und zeitnahe Umsetzung der Schulentwicklungsplanung sowie um zusätzliche personelle und räumliche Ressourcen zur Bewältigung der steigenden Zahl geflüchteter Schülerinnen und Schüler. Quelle:https://www.hwk-koeln.de/artikel/vollversammlung-waehlt-thomas-radermacher-zum-neuen-praesidenten-32,0,3078.html Pressemitteilung – PDF
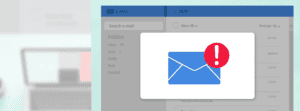
Achtung: Gefälschte Berufsgenossenschaft (BGN)-Schreiben und Rechnungen
Bild: Von Rawpixel @ elements.envato.com Achtung: Gefälschte Berufsgenossenschaft (BGN)-Schreiben und Rechnungen Kriminelle versenden aktuell postalisch sowie per E-Mail Schreiben an BGN-Mitgliedsunternehmen mit dem Betreff „Pflicht zur Anbringung des Augenspülstation-Schildes – Frist zur Umsetzung“ beziehungsweise „Wichtige Zahlungsaufforderung für Augenspül-Schild (verpflichtend)“. Den Schreiben beigefügt ist eine Rechnung, neuerdings erweitert um eine „Augenspülstation nach DIN-Norm“. Desweiteren werden Schreiben mit dem Absender „DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ mit dem Betreff „Einführung des digitalen Präventionsmoduls zum 1. Juli 2025Verpflichtende Teilnahme für alle Mitgliedsunternehmen – inkl. Beitragssenkung“ verschickt. Auch diese Schreiben sind Fälschungen und Betrug! Diese Schreiben sind mit hoher krimineller Energie gefälscht. Sowohl das Anschreiben als auch die Rechnung enthalten eine angebliche BGN-Telefonnummer, unter der sich die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe meldet. Vermutlich landen diese Anrufe in einem Call-Center im Ausland, die Verbrecher haben offensichtlich einen enormen Aufwand betrieben. Auch die Mail-Adresse, die in den Schreiben angegeben ist, ist falsch. Die verwendete Adresse „berufsgenossenschaft-nahrungsmittel-gastgewerbe.com“ wird auf die tatsächliche Seite der BGN weitergeleitet – auch dies ein Täuschungsmanöver. Mittlerweile variieren die verschiedenen Domain-Namen, auch hier hat die BGN entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Wichtig: Leisten Sie keine Zahlungen! Die BGN versendet grundsätzlich keine Rechnungen für Materialien, wie etwa für Schilder. Die Strafverfolgungsbehörden sind informiert, die BGN unternimmt alle möglichen rechtlichen Schritte – auch, um einen eventuellen Schaden für die Mitgliedsbetriebe möglichst klein zu halten. Sollten Sie bereits Zahlungen geleistet haben, melden Sie sich bitte per Mail an . Wir raten in diesen Fällen dringend zur Anzeige! Wenn Zweifel bestehen: Die Präventions-Hotline der BGN beantwortet unter 0621/4456-3517 alle Fragen, ob ein Anruf oder ein Schreiben tatsächlich von der BGN in Auftrag gegeben wurde. Weitere Informationen hier: https://www.bgn.de/presse/14-februar-2025-neue-betrugs-masche-mit-angeblichen-bgn-rechnungen

ZOB: Sieben Wirtschaftsorganisationen senden Brief an Ratsfraktion
Bild: Von duallogic @elements.envato.com ZOB: Sieben Wirtschaftsorganisationen senden Brief an Ratsfraktion Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotenpunkts muss bei Planung stärker im Vordergrund stehen Sieben Wirtschaftsorganisationen, darunter die Kreishandwerkerschaft Bonn·Rhein-Sieg, die Handwerkskammer zu Köln und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, haben sich in einem Brief an die Fraktionen im Bonner Stadtrat gewandt. Anlass ist der geplante Beschluss zu den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Vorplanung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Die Wirtschaftsorganisationen begrüßen die Pläne grundsätzlich, fordern jedoch, dass bei der Planung die verkehrliche Leistungsfähigkeit stärker im Vordergrund steht und die Kappung des Cityrings nicht zementiert wird. Teile des vorliegenden Konzepts, wie den Bau einer Fahrradgarage und die barrierefreie Gestaltung, bewerten die Wirtschaftsorganisationen positiv. Andere Aspekte sehen sie jedoch kritisch. „Suchtkranken Menschen muss geholfen werden, das ist klar. Der ZOB ist jedoch das Tor zur Stadt und der wichtigste Verkehrsknotenpunkt, deshalb teilen wir nicht die Sicht, dass ein Platz für die ‚Szene‘ hier richtig liegt“, sagt IHK-Präsident Stefan Hagen. Wiederherstellung des Cityrings muss möglich bleiben Als ungenutztes Potenzial sehen die Wirtschaftsorganisationen die Zufahrt zum ZOB über die Wesselstraße, die Busse aus Richtung Rathausgasse/Am Hof nutzen könnten. Zudem kritisieren sie, dass die Maximilianstraße nur noch für den Radverkehr bestimmt sein soll. Auch wenn die Trennung des Bus- und Radverkehrs vorteilhaft ist, müsse die Wiederherstellung des Cityrings weiterhin baulich möglich bleiben. „Für uns ist entscheidend, dass Lieferverkehre, Pflegedienste und Handwerksfahrzeuge ihre Kundschaft in einer vertretbaren Zeit erreichen können“, sagt Thomas Radermacher, Kreishandwerksmeister und Mitglied des Vorstands der Handwerkskammer zu Köln. Ihre Positionen haben die beteiligten Organisationen IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft, Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, DEHOGA Nordrhein, Einzelhandelsverband Bonn – Rhein/Sieg – Euskirchen und city-marketing Bonn e.V. auch in das städtische Beteiligungsverfahren eingebracht.

Freiwilliges Handwerksjahr für Jugendliche
Bilder v.l.n.r: Von westend61 / Von BGStock72 / Von acinar13 / Von friends_stock / @elements.envato.com Freiwilliges Handwerksjahr für Jugendliche Das regionale Handwerk spricht sich für die Einführung des freiwilligen Handwerksjahres in NRW aus. Wie soll es nach der Schule weitergehen? Auf diese Frage wissen immer mehr Jugendliche keine konkrete Antwort. „Ein Grund dafür ist, dass Schülerinnen und Schüler während ihrer Schulzeit viel zu selten mit der Berufswelt in Kontakt kommen“, bedauert Jan Bauer, Präsident des Landesverbandes der Kreishandwerkerschaften in NRW und Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Bonn · Rhein-Sieg. „Wir wissen, dass rund 70 Prozent aller Auszubildenden erst über ein Praktikum zu ihrer Ausbildung gefunden haben.“ Ergänzend zu verpflichtenden und freiwilligen Praktika ist in Schleswig-Holstein ein interessantes Projekt entstanden, das für Nordrhein-Westfalen Vorbild sein kann: Das freiwillige Handwerksjahr. „Analog zu einem freiwilligen sozialen Jahr haben Jugendliche hier nach dem Abschluss der Schule die Möglichkeit, Handwerksberufe näher kennenzulernen.“ Erste Erfahrungen bei der Handwerkskammer Lübeck, in deren Einzugsgebiet das „freiwillige Handwerksjahr“ gestartet ist, seien ausgesprochen positiv, berichtet Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher. Rund 150 Betriebe und über 80 Jugendliche hätten sich gemeldet, mit Förderung des Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche Bildung seien zunächst 25 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren in ein freiwilliges Handwerksjahr gestartet. Neben wertvollen Berufserfahrungen und der Erkenntnis, ob ein gewähltes Berufsfeld auch für eine spätere Ausbildung in Frage kommt, gibt es beim freiwilligen Handwerksjahr in Schleswig-Holstein monatlich 450 Euro Aufwandsentschädigung. „Ein solches freiwilliges Handwerksjahr, angelehnt an die Regelungen eines freiwilligen sozialen Jahres wünschen wir uns auch in NRW“, macht Oliver Krämer, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg deutlich. „Wir werden in den Dialog mit der Politik und den Handwerkskammern gehen, um das Projekt voranzutreiben.“ Insbesondere von der Politik benötigt das Handwerk Unterstützung. „Wir brauchen Rechtssicherheit in Punkten wie Mindestvergütung, Kettenverleih, also Ausbildung in unterschiedlichen Unternehmen, und Befreiung von der Schul- oder Berufsschulpflicht während eines freiwilligen Handwerksjahres.“

Finanzverwaltung stellt kostenfreie Software zum Lesbarmachen von E-Rechnungen zur Verfügung
Bild: Von DC_Studio @elements.envato.com Finanzverwaltung stellt kostenfreie Software zum Lesbarmachen von E-Rechnungen zur Verfügung Ab dem 1. Januar 2025 sind alle inländischen Unternehmen verpflichtet, elektronische Rechnungen zu empfangen. Um elektronische Rechnungen im Format XRechnung lesen und prüfen zu können, brauchen die Betriebe eine Software zur Visualisierung des Datensatzes (so genannte Viewer). Die Handwerksorganisationen haben sich nachdrücklich bei der Bundesregierung für eine kostenfreie staatliche Software der Finanzverwaltung eingesetzt. Das Bundesfinanzministerium ist dieser Forderung nunmehr noch rechtzeitig vor dem 1.1.2025 nachgekommen. Der E-Rechnungsviewer der Finanzverwaltung ist auf dem ELSTER-Portal freigeschaltet und unter folgenden Internet-Adressen erreichbar: https://www.elster.de/eportal/e-rechnunghttp://www.erechnung.elster.dehttp://www.e-rechnung.elster.de Alles rund um das Thema E-Rechnung hat der ZDH auf seiner Seite https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-steuern-und-finanzen/elektronische-rechnung/ veröffentlicht.

Jahresbilanz am Ausbildungsmarkt in Bonn/Rhein-Sieg 2023/2024
Präsentierten ihre Jahresbilanz am Ausbildungsmarkt 2023/24 (v. l. n. r.): Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Janin Fester, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg; Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn; Ulrike Pütz, Abteilungs- leitung Karrierewerkstatt der HWK Köln; Ralf Steinhauer, Leiter der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bonn. Bildnachweis: Agentur für Arbeit Bonn
Elektronische Kassen – jetzt kommt die Meldepflicht!
Seit 2019 ist die Meldepflicht für elektronische Kassensysteme mit TSE ausgesetzt. Nun soll ab 1. Januar 2025 ein Verfahren zur Meldung der elektronischen Kassensysteme zur Verfügung stehen. Ab 1. Juli 2025 müssen alle neu angeschafften Systeme innerhalb eines Monats gemeldet werden. Für bestehende gilt eine Übergangsfrist bis zu 31. Juli 2025. Betriebe müssen ab kommendem Jahr ihre elektronischen Kassensysteme bei ihrem Finanzamt melden. Ab 1. Januar 2025 werde die elektronische Übermittlung über das Programm „Mein Elster“ und die ERiC-Schnittstelle möglich sein, teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem BMF-Schreiben mit (IV D 2 – S 0316-a/19/10011 :009). Ursprünglich sollte die Meldepflicht schon 2020 kommen. Sie wurde allerdings mehrfach verschoben, weil es kein Verfahren dafür gab. Regelungen und Fristen für die Meldung Nun müssen Handwerker handeln. Das bedeutet: Sie müssen alle Registrierkassen und andere elektronische Aufzeichnungssysteme sowie die dazugehörigen zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE), die in Ihrem Betrieb angeschafft wurden, melden. Folgende Regelungen und Fristen gelten: Alle vor dem 1. Juli 2025 angeschafften elektronischen Kassensysteme müssen bis zum 31. Juli 2025 gemeldet werden. Alle ab dem 1. Juli 2025 angeschafften Systeme müssen innerhalb eines Monats nach Anschaffung gemeldet werden. Das gilt auch für gemietete und geleaste Kassensysteme. Systeme, die ab dem 1. Juli 2025 außer Betrieb gehen und nicht mehr im Betrieb vorgehalten werden, müssen innerhalb eines Monatsabgemeldet werden. Systeme, die vor dem 1. Juli 2025 außer Betrieb gehen, müssen nur abgemeldet werden, wenn sie zuvor angemeldet worden sind. Bei jeder Mitteilung müssen stets alle elektronischen Aufzeichnungssysteme einer Betriebsstätte in der einheitlichen Mitteilung übermittelt werden. Wer ist von der Meldepflicht betroffen? Betroffen sind von der Meldepflicht Kassensysteme und elektronische Registrierkassen. Was genau dazu zählt und welche Informationen übermittelt werden müssen, hat das Bundesfinanzministerium 2023 in einem BMF-Schreiben konkretisiert (IV A 4 – S 0316-a/18/10001): Als elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen gelten für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen und deren Abrechnung spezialisierte elektronische Aufzeichnungssysteme, die eine Kassenfunktion haben. Als Kassenfunktion gilt es, wenn ein Aufzeichnungssystem der Erfassung und Abwicklung von zumindest teilweise baren Zahlungsvorgängen dienen kann. Dies gilt auch für „vergleichbare elektronische, vor Ort genutzte Zahlungsformen“ wie zum Beispiel Geldkarten, virtuelle Konten oder Bonuspunktesysteme von Drittanbietern, wie auch „an Geldes statt“ angenommener Gutscheine, Guthabenkarten, Bons und dergleichen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für Bargeld, etwa in Form einer Kassenlade, spielen hingegen keine Rolle. Folgende Informationen müssen laut BMF gemeldet werden: Name des und Steuernummer des Steuerpflichtigen. Nach Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer muss diese gemeldet werden. Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung mit Zertifizierungs-ID sowie der Seriennummer (nach § 146a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 AO), Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, Anzahl der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme (je Betriebsstätte / Einsatzort), Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, Datum der Anschaffung des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems, Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems.

Tag des Handwerks 2024
Erfolgreicher Tag des Handwerks 2024 Am Freitag, den 20. September 2024, feierte die Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg in der Kleinen Beethovenhalle in Bonn den diesjährigen Tag des Handwerks. Unter der Moderation von Sonja Fuhrmann erlebten die Gäste einen Abend voller informativer Gespräche und würdigender Ehrungen, der die zentrale Rolle des Handwerks in der Region hervorhob. Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher eröffnete den Abend mit einer Begrüßung und freute sich, Dr. Norbert Röttgen als Diskussionspartner auf der Bühne willkommen zu heißen. In einer Interviewrunde erörterten sie die aktuelle Lage in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf das Handwerk. Im Anschluss konnten die Gäste Fragen an die Experten stellen. v.l.n.r.: Thomas Radermacher, Dr. Norbert Röttgen, Sonja Fuhrmann Preisträger „Handwerksbetrieb des Jahres 2024“: Parkett Preuß GmbH Preisträger der Kategorie „Nachhaltigkeit“: Braun Gebäudereinigung GmbH & Co.KG Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Titels „Handwerksbetrieb des Jahres“ an die Parkett Preuß GmbH. In seiner Laudatio betonte Oliver Krämer: „Die Firma Preuß verkörpert die Werte des Handwerks – von Tradition und Innovation über Gemeinschaftssinn bis hin zur Verantwortung für kommende Generationen. Sie dient als Vorbild für alle, die im Handwerk tätig sind.“ Die Auszeichnung in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ erhielt die Braun Gebäudereinigung GmbH & Co. KG. Thomas Radermacher würdigte in seiner Rede: „Die Gebäudereinigung Braun steht für Nachhaltigkeit in vielen Bereichen – vom umweltschonenden Einsatz von Ressourcen bis hin zur Integration von Mitarbeitenden aus 50 Nationen. Ihr soziales Engagement für die wertvollste Ressource des Unternehmens, den Menschen, ist besonders hervorzuheben.“ Für ihr „Besonderes Engagement“ wurden Jens Kessner und Ulrich Bogusch ausgezeichnet. Frank Jäger, Leiter der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, lobte Jens Kessner: „Ich habe großen Respekt vor Menschen, die ihre berufliche Tätigkeit auch als Berufung ansehen. Jens Kessner ist einer dieser Menschen.“ Jan Bauer, Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung, hob in seiner Laudatio für Ulrich Bogusch hervor: „Ulrich Bogusch zeigt seit vielen Jahren außergewöhnliches Engagement – vom Einsatz für innovative Ausbildungsprogramme bis hin zu Pilotprojekten für die Nachwuchswerbung. Er ist ein Vorbild in der Region.“ Den Abschluss des Abends bildete die Ehrung der Prüfungsbesten des Jahrgangs 2023/24. Ausgezeichnet wurden Maximilian Schumacher (Karosseriebauer, Christian Kohr GmbH), Tom Seiler (Friseur, Andreas Garweg) und Elia Magnus Zeitler (Kfz-Mechatroniker, Auto Thomas GmbH), die für ihre herausragenden Leistungen Urkunden und Gutscheine erhielten. Beim anschließenden Imbiss nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich über die Chancen und Herausforderungen im Handwerk auszutauschen. Der Tag des Handwerks 2024 war ein voller Erfolg und unterstrich erneut die zentrale Rolle des Handwerks in der Wirtschaftsregion Bonn/Rhein-Sieg. Bilder:Fotograf Marco Rothbrust Auszeichnung „Besonderes Engagement“: Jens Kessner Auszeichnung „Besonderes Engagement“: Ulrich Bogusch Ehrung der Prüfungsbesten des Jahrgangs 2023/24 Impressionen des Abends Tag des Handwerks Preview_042 Tag des Handwerks Preview_037 Tag des Handwerks Preview_035 Tag des Handwerks Preview_022 Tag des Handwerks Preview_012 Tag des Handwerks Preview_007 Tag des Handwerks Preview_003 Preisträger Kessner Preisträger der Kategorie „Nachhaltigkeit“: Braun Gebäudereinigung GmbH & Co.KG Tag des Handwerks Preview_046 Tag des Handwerks Preview_039 Tag des Handwerks Preview_036 Tag des Handwerks Preview_031 v.l.n.r.: Thomas Radermacher, Dr. Norbert Röttgen, Sonja Fuhrmann Tag des Handwerks Preview_014 Tag des Handwerks Preview_013 Tag des Handwerks Preview_010 Tag des Handwerks Preview_009 Tag des Handwerks Preview_001 Preisträger „Handwerksbetrieb des Jahres 2024“: Parkett Preuß GmbH Preisträger Beste Azubis I Preisträger Beste Azubis Gesamt Tag des Handwerks Preview_038 Tag des Handwerks Preview_034 Tag des Handwerks Preview_030 Tag des Handwerks Preview_027 Tag des Handwerks Preview_020 Tag des Handwerks Preview_019 Tag des Handwerks Preview_017 Tag des Handwerks Preview_015 Tag des Handwerks Preview_008 Tag des Handwerks Preview_006 Tag des Handwerks Preview_004 Tag des Handwerks Preview_040 Tag des Handwerks Preview_029 Tag des Handwerks Preview_026 Tag des Handwerks Preview_025 Tag des Handwerks Preview_023 Tag des Handwerks Preview_021 Tag des Handwerks Preview_016 Tag des Handwerks Preview_011 Tag des Handwerks Preview_005 Auszeichnung „Besonderes Engagement“: Jens Kessner Auszeichnung „Besonderes Engagement“: Ulrich Bogusch Preisträger Azubis II Tag des Handwerks Preview_002

Wie man ein rechtssicheres Website-Impressum gestaltet
Bild: Von karandaev @elements.envato.com Betreiberinnen und Betreiber von Websites, insbesondere im Handwerksbereich, sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen auf ihrer Website bereitzustellen. Ein zentraler Bestandteil dieser Pflicht ist das Impressum. Dieser Artikel erläutert die wesentlichen Aspekte und Pflichtangaben eines Impressums, beleuchtet spezielle Anforderungen für bestimmte Handwerksberufe und hebt hervor, warum es wichtig ist, das Impressum aufgrund der geänderten Gesetzesgrundlage anzupassen. Warum ist ein Impressum notwendig? Handwerkerinnen und Handwerker, die eine Unternehmenswebsite betreiben, müssen spezifische Informationen über sich und ihren Betrieb bereitstellen. Diese Pflicht ergibt sich aus § 5 des neuen Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG), dass das frühere Telemediengesetz (TMG) ersetzt hat. Da die Impressumspflicht nun nicht mehr im TMG, sondern im DDG geregelt ist, ist es entscheidend, dass Website-Betreiber ihr Impressum an diese neue Rechtslage anpassen. Eine falsche oder veraltete Gesetzesnennung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das Impressum selbst dient dazu, dass Kundinnen und Kunden leicht Kontakt aufnehmen oder sich bei den zuständigen Aufsichtsbehörden über die Seriosität des Betriebs informieren können. Durch die korrekte Angabe der aktuellen Gesetzesgrundlage zeigen Sie, dass Sie rechtlich auf dem neuesten Stand sind, was das Vertrauen Ihrer Kundschaft stärkt. Wo sollte das Impressum platziert sein? Das Impressum muss mit maximal zwei Klicks erreichbar sein. Am besten platzieren Sie den Link zum Impressum im sogenannten „Footer“ (Fußzeile) der Website, da dieser Bereich auf jeder Seite der Website sichtbar ist und damit die Anforderung der leichten Erreichbarkeit erfüllt. Welche Angaben müssen im Impressum stehen? Name, Anschrift, Rechtsform Die vollständige Postanschrift des Betriebs ist anzugeben. Bei juristischen Personen (etwa GmbH oder Genossenschaft) müssen zusätzlich die Rechtsform, die vertretungsberechtigten Personen, gegebenenfalls das Stammkapital und die Höhe der ausstehenden Einlagen genannt werden. Kontaktdaten Es sind sowohl eine E-Mail-Adresse als auch eine Telefonnummer anzugeben, um eine einfache Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Aufsichtsbehörde Für Tätigkeiten, die eine behördliche Zulassung erfordern, muss die zuständige Aufsichtsbehörde genannt werden. Im Handwerk betrifft dies insbesondere Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger und Büchsenmacher. Registereintragungen Ist der Betrieb in einem Register eingetragen, beispielsweise im Handels- oder Genossenschaftsregister, müssen das entsprechende Register sowie die Registernummer angegeben werden. Angaben bei bestimmten reglementierten Berufen Für Betriebe, die ein Gesundheitshandwerk ausüben, sind zusätzliche Angaben erforderlich: • Die zuständige Handwerkskammer• Die gesetzliche Berufsbezeichnung (z.B. Augenoptiker, Zahntechniker)• Deutschland als das Land, in dem die Berufszulassung erteilt wurde• Die Handwerksordnung als berufsrechtliche Regelung Umsatzsteueridentifikationsnummer Falls vorhanden, muss die Umsatzsteueridentifikationsnummer im Impressum aufgeführt werden. Abwicklung oder Liquidation Befindet sich der Betrieb als Kapitalgesellschaft in Abwicklung oder Liquidation, muss auch dies im Impressum vermerkt werden. Welche Konsequenzen drohen bei fehlerhaftem Impressum? Fehlerhafte oder fehlende Angaben im Impressum stellen einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht dar. Dies kann dazu führen, dass Mitbewerber oder befugte Organisationen, wie Verbraucherzentralen, eine kostenpflichtige Abmahnung aussprechen. Besonders wichtig ist es, die Gesetzesgrundlage im Impressum korrekt anzugeben. Die Umstellung von TMG auf DDG erfordert eine Anpassung, um rechtlichen Problemen vorzubeugen. Außergerichtliche Streitbeilegung Es ist ratsam, auch die Pflichtangaben zur außergerichtlichen Verbraucherschlichtung in das Impressum zu integrieren. Dazu gehört insbesondere die Information über die Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Verfahren. Wird auf der Webseite ein Online-Shop betrieben, muss außerdem ein Link zur Streitschlichtungsplattform angegeben werden. Verbraucherschlichtung ist freiwillig Die Teilnahme an einer Verbraucherschlichtung ist für alle Beteiligten freiwillig. Das Verfahren eignet sich besonders, wenn Kunden ihre Verbraucherechte geltend machen wollen. Die Vorteile der Verbraucherschlichtung sind die schnelle Abwicklung über das Internet und die Möglichkeit, dass gesetzliche Verbraucherrechte nicht zwingend beachtet werden müssen. Ein Nachteil ist jedoch, dass Unternehmer das Verfahren nicht beantragen können und die Verfahrenskosten allein tragen müssen.

Kreishandwerkerschaft Bonn·Rhein-Sieg feiert Sommerfest und 175-jähriges Jubiläum der Innung für Metalltechnik
Kürzlich fand das jährliche Sommerfest der Kreishandwerkerschaft Bonn·Rhein-Sieg statt, das in diesem Jahr durch ein besonderes Ereignis bereichert wurde: die Feier zum 175-jährigen Jubiläum der Innung für Metalltechnik. Bei strahlendem Sonnenschein und einer festlichen Atmosphäre kamen zahlreiche Gäste zusammen, um diesen besonderen Anlass gebührend zu feiern. Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher eröffnete das Fest und betonte in seiner Rede die herausragende Bedeutung der Innung für Metalltechnik für die Region. „175 Jahre Handwerkstradition in der Metalltechnik sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die Innovationskraft und den Zusammenhalt unseres Handwerks,“ so Radermacher. Im Anschluss an seine Eröffnungsrede sprach Willi Seiger,Präsident des Bundesverbandes Metall und würdigte die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Verband und der Innung Bonn·Rhein-Sieg. Besonders hervorzuheben war der Auftritt von Dr. Erik Werdel, dem neuen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln. Werdel nutzte seinen ersten Besuch bei einer Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft, um die Bedeutung des Handwerks für die regionale Wirtschaft und die lokale Gemeinschaft zu unterstreichen. Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher – Bild: KHS v.l.: Willi Seiger (Präsident des Bundesverbandes Metall), Janin Fester (Geschäftsführerin Innung für Metalltechnik), Dr. Erik Werdel (Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer zu Köln), Thomas Radermacher (Kreishandwerksmeister), Hans-Bernd Grönewald (Obermeister Innung für Metalltechnik) und Oliver Krämer (Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft) – Bild: KHS Anny Ogrezeanu – Bild: KHS Musikalisch wurde das Fest von Anny Ogrezeanu, der Gewinnerin von „The Voice of Germany 2022“ begleitet, die mit ihrem Auftritt für eine fröhliche und begeisterte Stimmung sorgte. Ein besonderes Highlight des Abends war die Spendenaktion zugunsten des Vereins Sankt Augustin and friends hilft e.V., der Hilfslieferungen in die Ukraine organisiert. Alle Gäste hatten die Möglichkeit, für diesen wichtigen Zweck zu spenden. Gunther Maassen, 1. Vorsitzender des Vereins, stellte die Arbeit des Vereins vor und bedankte sich herzlich bei den Anwesenden für ihre großzügige Unterstützung. Zusätzlich hatten die Gäste die Gelegenheit, an besonderen Mitmach-Ständen ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen: Hier konnten sie unter Anleitung ihr Können am Schweiß-Simulator oder ihr Geschick beim Formen von Rosen aus Metall zeigen. Dieses Angebot erfreute sich großer Beliebtheit und bot den Besuchern eine tolle Erinnerung an den Abend. Gunther Maassen, 1. Vorsitzender – Sankt Augustin and friends hilft e.V. – Bild: KHS Das Sommerfest der Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg schreibt auch in diesem Jahr die Erfolgsgeschichte fort und bot eine ideale Gelegenheit für Austausch und Vernetzung im Handwerk. Die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum der Innung für Metalltechnik unterstrichen die traditionsreiche Geschichte und die fortwährende Relevanz des Handwerks in der Region. Impessionen
Erste Wirtschaftsparkplätze in Bonn eingerichtet
Die Stadt Bonn richtet in der Südstadt und Kessenich Wirtschaftsparkplätze ein, welche tagsüber Handwerk, Pflege und Lieferverkehr vorbehalten sind. Bonn gehört zu den ersten Kommunen in Deutschland, welche Wirtschaftsparkplätze anbieten und nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Förderung des Wirtschaftsverkehrs ein. Die Städte Bonn und Köln haben sich in Abstimmung mit der Handwerkskammer (HWK) zu Köln sowie der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg darauf verständigt, Wirtschaftsparkplätze in einem einheitlichen Format einzurichten. Da die Umsetzung in Köln noch Zeit in Anspruch nehmen wird, beginnt die Stadt Bonn zunächst in einem eigenen Pilotprojekt mit der Ausweisung erster Wirtschaftsparkplätze und hat dafür auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg miteinbezogen. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher, IHK-Präsident Stefan Hagen und HWK-Geschäftsführerin für Unternehmensberatung, Handwerkspolitik und Internationales, Stephanie Bargfrede, gaben am Donnerstag, 22. August, die ersten Wirtschaftsparkplätze in der Hausdorffstraße, vor der Pfarrkirche St. Nikolaus, frei. In den kommenden Tagen werden an zunächst insgesamt neun Standorten in Kessenich und in der Südstadt Handwerk, Pflege und Lieferverkehr zukünftig schneller und verlässlicher eine Parkmöglichkeit finden können. OB Dörner: „Schaffen Platz für den Wirtschaftsverkehr“ Die Wirtschaftsparkplätze sind ein wichtiger Baustein zur Förderung des Wirtschaftsverkehrs im Rahmen der Bonner Mobilitätswende. Wenn die Wirtschaftsparkplätze gut angenommen werden, sollen weitere Standorte im gesamten Stadtgebiet folgen. Oberbürgermeisterin Katja Dörner: „Wir schaffen Platz für den Wirtschaftsverkehr in Bonn und hoffen, dass die neuen Wirtschaftsparkplätze gut angenommen werden. Denn sie sollen erst der Anfang sein.“ Die Stadt Bonn nimmt die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs in ihren Planungen stärker in den Blick. Dazu die Oberbürgermeisterin: „Zusätzlich zu den Wirtschaftsparkplätzen richten wir vermehrt Ladezonen ein. Auch in den neuen Fahrradstraßen gibt es Platz für den Wirtschaftsverkehr: Mit dem Handwerkerparkausweis kann dort im eingeschränkten Halteverbot für den Einsatz geparkt werden. Damit gehen wir auf wichtige Forderungen der Wirtschaftsverbände ein.“ Statement Handwerkskammer zu Köln „Mit unserem Vorschlag zu den Wirtschaftsparkplätzen haben wir nicht nur an unsere Mitgliedsbetriebe, sondern auch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bonn gedacht. Wir wollen vermeiden, dass Handwerksunternehmen in bestimmten Vierteln keine Aufträge mehr annehmen, weil sie keine Chance haben, die für ihre Arbeit erforderlichen Werkstattwagen abzustellen“, betont Stephanie Bargfrede. „Handwerkerleistungen sollen sich auch nicht durch explodierende Anfahrtskosten ungewollt verteuern. Wenn wir es schaffen, die unnötigen gewerblichen Parksuchverkehre zu reduzieren, tragen wir auch zur Verbesserung der Luftqualität bei. Wir brauchen ein ausgewogenes Verkehrskonzept sowohl für den fließenden als auch den ruhenden Verkehr. Verkehrspolitik darf nicht dazu führen, dass Versorgungsketten geschwächt oder gar unterbrochen werden. Darunter würde in absehbarer Zeit auch die Lebensqualität in der Stadt Bonn leiden.“ Statement Kreishandwerkerschaft „Wir haben uns für die Verwirklichung der Wirtschaftsparkzonen in Bonn von Anfang an eingesetzt. Es ist schön zu sehen, dass dieser Einsatz nun auch erste zarte Früchte trägt“, sagt Thomas Radermacher. „Für unsere Handwerksbetriebe ist es von großer Bedeutung, dass die Kunden mit dem Fahrzeug erreicht werden, und die Fahrzeuge in der Nähe zum Auftragsort abgestellt werden können. Werkzeug, Material, Ersatzteile, Schutzausrüstung etc. werden transportiert und sind oft essenziell für die Arbeiten. Durch die Nähe zum Auftragsort können die geplanten zeitlichen Abläufe bei der Bearbeitung der Aufträge eingehalten werden. Wir gehen davon aus, dass durch die Wirtschaftsparkplätze die Motivation der Betriebe wieder steigt, auch Aufträge in Bonn anzunehmen. Wir sind gespannt, wie die Parkplätze angenommen werden und setzen uns weiterhin dafür ein, dass dieses Konzept ausgebaut wird.“ Statement Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg „Die angestrebte Verkehrswende wird nur dann Erfolg haben, wenn die Stadt gut für den Wirtschaftsverkehr erreichbar ist. Dafür gibt es unterschiedliche Bausteine. Neben schon bewährten wie dem Ausbau des ÖPNV zählen dazu potenziell auch neue Konzepte“, erläuterte Stefan Hagen. „Für dicht bebaute Viertel mit hohem Parkdruck sind das die Wirtschaftsparkplätze. Wir finden es gut, dass die Stadt Bonn hier einen Praxistest vornimmt. Nur so können wir klären, wie das neue Modell angenommen wird und ob damit Pflegedienste, Lieferanten und weitere Dienstleister ihre Ziele in urbanen Räumen besser erreichen können.“ Neun Standorte abgestimmt Die Standorte für das Pilotprojekt wurden in Zusammenarbeit mit Handwerk, Pflegediensten und Logistik gemeinsam entwickelt. In den vergangenen Wochen optimierte die Stadt die Bereiche im Dialog mit dem Einzelhandel vor Ort weiter. Folgende Standorte werden jetzt eingerichtet: Hausdorffstraße 145-151 und 234 sowie an der Pfarrkirche Pützstraße 8 Bismarckstraße 19 Ermekeilstraße 36 Lessingstraße 51 Bonner Talweg im Bereich der IHK sowie der Telekom Einheitliche Markierung und Beschilderung Die Wirtschaftsparkplätze werden in einem einheitlichen Standard, den die Stadt Bonn entwickelt hat, markiert und beschildert. Eine gut erkennbare, eindeutige Beschilderung sowie farbliche Bodenmarkierungen inklusive verdeutlichender Piktogramme sollen gewährleisten, dass diese Zonen nicht durch fremdparkende Fahrzeuge blockiert werden. Die Wirtschaftsparkzonen sind werktags von 8 bis 18 Uhr dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten; außerhalb dieser Zeiten darf dort regulär geparkt werden. Die ausgewiesenen Flächen dürfen Fahrzeuge mit Handwerkerparkausweisen oder mit Ausnahmegenehmigungen für soziale Dienste, Paketzusteller und der Lieferverkehr nutzen, die in der Umgebung ihre Kund*innen erreichen möchten. Mit den Wirtschaftsparkplätzen verfolgt die Stadt gleich mehrere Ziele: In Gebieten mit einem hohen Parkdruck entfällt die (zeit-)aufwändige Parkplatzsuche. Firmenfahrzeuge müssen nicht ordnungswidrig auf Gehwegen, auf Fahrradschutzstreifen oder in Parkverboten abgestellt werden; dies erhöht die Verkehrssicherheit. Handwerker, Paketboten und Pflegedienste können ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zu ihren Kund*innen abstellen. Die Stadt beobachtet im Rahmen des Pilotprojekts in den kommenden Monaten die Nutzung der Wirtschaftsparkplätze und wird diese auswerten. Bei positivem Ergebnis prüft die Verwaltung, wo weitere Standorte im Stadtgebiet eingerichtet werden können.
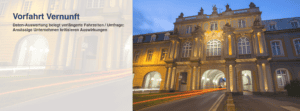
Verkehrsversuch auf der Bonner Adenauerallee fällt bei Wirtschaft durch
Verkehrsversuch auf der Bonner Adenauerallee fällt bei Wirtschaft durch Daten-Auswertung belegt verlängerte Fahrzeiten / Umfrage: Ansässige Unternehmen kritisieren Auswirkungen Die Fahrzeiten für den motorisierten Verkehr haben sich während des Verkehrsversuchs auf der Adenauerallee insbesondere zu Spitzenverkehrszeiten deutlich verlängert. Das belegen Verkehrsdaten, die die Initiative Vorfahrt-Vernunft in Kooperation mit dem ADAC Nordrhein ausgewertet hat. Zudem zeigt eine gemeinsame Umfrage von Handwerkskammer zu Köln und Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, dass die Mehrheit der ansässigen Unternehmen mit den Auswirkungen des Verkehrsversuchs auf der Adenauerallee sehr unzufrieden ist. Die in der Initiative Vorfahrt-Vernunft aktiven Wirtschaftsorganisationen fordern deshalb ein angepasstes Konzept für diese wichtige Verkehrsachse. „Die Adenauerallee ist nicht irgendeine Straße, sondern eine Bundesstraße und zentrale Verkehrsachse für Bonn und die Erreichbarkeit der Innenstadt“, sagt IHK-Präsident Stefan Hagen. „Wir waren vor dem Start des Versuchs skeptisch und sehen uns darin durch diese Daten, aber auch durch die vielen persönlichen Rückmeldungen und Eindrücke aus den vergangenen Monaten bestätigt. Das getestete Konzept hat sich nicht bewährt und darf jetzt nicht zur Dauerbelastung für die betroffenen Unternehmen werden. Wir müssen gemeinsam einen Kompromiss für die Adenauerallee finden, der die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs angemessen berücksichtigt.“ Auswertung: In der Spitze nahezu doppelte Fahrtzeit In Kooperation mit dem ADAC Nordrhein hat Vorfahrt-Vernunft von März bis Mai 2024 Verkehrsdaten (Floating-Car-Daten) auswerten lassen. „Mit der Bereitstellung der Daten möchten wir zu einer Versachlichung der Diskussionen rund um den Verkehrsversuch beitragen“, sagt Prof. Dr. Roman Suthold, Fachbereichsleiter Verkehr und Umwelt des ADAC Nordrhein. Die Datenanalyse zeigt: In Süd-Nord-Richtung hat sich die Fahrzeit auf der Adenauerallee zur Spitzenzeit gegen 18 Uhr nahezu verdoppelt. Im Durchschnitt hat die Fahrzeit zwischen Bundeskanzlerplatz und Koblenzer Tor laut der Auswertung in den Hauptverkehrszeiten (7 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr) im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zugenommen. In der umgekehrten Fahrtrichtung (Nord-Süd) benötigen Pkw und Lkw zu den Hauptverkehrszeiten durchschnittlich knapp 40 Prozent mehr Zeit, in der Spitze (rund um 9 Uhr) mehr als 50 Prozent. Tragbare Lösung für alle gesucht „Natürlich brauchen wir eine bessere Radinfrastruktur in den Städten. Eine gute Erreichbarkeit der Innenstädte muss aber für notwendige Kfz-Verkehre auch in Zukunft erhalten bleiben. Es sollte eine für alle tragbare Lösung gefunden werden“, sagt ADAC-Experte Suthold. An der Befragung von IHK und HWK haben sich im Mai knapp 200 Mitgliedsbetriebe der beiden Wirtschaftsorganisationen beteiligt, die an der Adenauerallee oder in ihrem Einzugsbereich ansässig sind. 60 Prozent der Unternehmen geben dem Verkehrsversuch die Noten „mangelhaft“ oder „ungenügend“. Handwerksbetriebe wissen nicht mehr, wo sie halten können „Seit Beginn des Verkehrsversuchs ist das Laden und Liefern auf der Adenauerallee deutlich schwieriger geworden“, sagt Thomas Radermacher, Kreishandwerksmeister und Mitglied des Vorstands der HWK. „Es gibt zu wenige Halte- und Parkmöglichkeiten. Mit dem Fahrradweg fällt eine Spur weg, sodass Handwerksbetriebe häufig gar nicht wissen, wo sie halten können. Wie das erst funktionieren soll, wenn die Fahrradspur auch noch wie von der Stadt geplant mit einer Barriere abgegrenzt werden sollte, ist mir ein Rätsel.“ Dementsprechend sind laut der Umfrage viele ansässige Unternehmen sehr unzufrieden mit der Erreichbarkeit ihres Betriebes für Pkw und Lkw. Insgesamt spricht sich nur ein Viertel der befragten Unternehmen dafür aus, die im Verkehrsversuch erprobte Straßenaufteilung beizubehalten. Mehr als 70 Prozent lehnen das ab. Davon wiederum wünscht die eine Hälfte, also 36,5 Prozent der Unternehmen, eine Rückkehr zum Zustand vor dem Verkehrsversuch. Die andere Hälfte spricht sich dafür aus, den Radverkehr komplett auf Rheinufer und Kaiserstraße zu verlagern und auch den Schutzstreifen für Radfahrende, der vor dem Versuch auf der Adenauerallee markiert war, zu entfernen. Vorfahrt-Vernunft wirbt für Kompromiss Mit Blick auf Datenauswertung und Umfrage wirbt die Initiative Vorfahrt-Vernunft dafür, einen Kompromiss für die wichtige Verkehrsachse zu suchen. „Im Rahmen der Umfrage haben viele Unternehmen selbst Vorschläge zur Straßenaufteilung eingebracht und auch die Wirtschaftsorganisationen haben Ideen, über die wir mit den zuständigen Stellen sprechen möchten, zum Beispiel ein Kfz-Vorrangroutennetz“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Hille. „Wir benötigen dringend ein ausgewogenes und auf die gesamte Region Bonn/Rhein-Sieg abgestimmtes Verkehrskonzept. Die bisherigen Diskussionen über einzelne Verkehrsprojekte waren und sind immer nur Stückwerk und werden den komplexen Fragestellungen an Mobilität nicht gerecht.“ Vorfahrt-Vernunft ist eine Initiative der Wirtschaftsorganisationen Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, Handwerkskammer zu Köln, Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen und city-marketing Bonn. Das Bündnis setzt sich dafür ein, dass Wirtschaftsverkehre in der Region Bonn/Rhein-Sieg möglichst schnell und effizient fließen können und eine gute Erreichbarkeit von Geschäften, Kunden, Gewerbestandorten und Büros gewährleistet bleibt. Mehr erfahren Sie unter ► www.vorfahrt-vernunft.de… Quelle: https://www.hwk-koeln.de/artikel/verkehrsversuch-auf-der-bonner-adenauerallee-faellt-bei-wirtschaft-durch-32,0,2937.html

Ausbildungsmarkt in der Region stabilisiert – Duale Ausbildung bleibt große Chance für beruflichen Erfolg
Foto:Agentur für Arbeit Bonn; v.l.: Ralf Steinhauer, Janin Fester, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Bonn • Rhein-Sieg, Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn Ausbildungsmarkt in der Region stabilisiert – Duale Ausbildung bleibt große Chance für beruflichen Erfolg Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt in Bonn/Rhein-Sieg 2023/2024 auf der Ausbildungsbörse 2024 Die Agentur für Arbeit Bonn, die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg(IHK), die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg und die Handwerkskammer zu Köln präsentierten in ihrer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag, den 9. April 2024, die Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt des Berufsberatungsjahres 2023/24 für die Region. Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn, sagt: „Im Vergleich zu den beiden Vorjahren können wir sowohl einen Aufwärtstrend bei den Stellen als auch bei den an einer Ausbildung interessierten jungen Menschen feststellen. Dabei übersteigt die Zahl an Ausbildungsstellen die der Bewerberinnen und Bewerber leicht. Dies könnte bedeuten, dass der Abwärtstrend auf beiden Marktseiten vorerst gestoppt ist. Dennoch bleibt es dabei: Der Ausbildungsmarkt unserer Tage ist ein Bewerbermarkt.“ Akquise von AusbildungsstellenDie Agentur für Arbeit konnte seit Beginn des Berichtsjahres 3.851Ausbildungsstellen einwerben. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 751 Stellen mehr oder ein Plus von 24,2 Prozent. Dabei wurden allein im Rhein-Sieg-Kreis 597 Stellen oder 35,3 Prozent mehr gemeldet als Anfang 2023. Auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern zeigt sich ein solches Plus: Insgesamt 3.551 Menschen haben ihr Interesse an einer Ausbildungsstelle signalisiert, das sind 400 Personen und 12,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Das steigende Interesse zeigt sich sowohl bei den weiblichen (+7,7 Prozent) als auch bei den männlichen Jugendlichen (+15,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Ralf Steinhauer, Leiter der Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit Bonn, begründet den Aufwärtstrend so: „Zum einen haben wir den Kontakt zu den Unternehmen intensiviert und verstärkt für die Einrichtung von Ausbildungsstellen geworben. Dabei haben wir gerade die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angesprochen, die während der Coronapandemie ihr Angebot zurückgefahren haben. Zum anderen haben wir unser Angebot an Beratungen und Berufsorientierungsveranstaltungen stark ausgeweitet. Dabei haben wir sowohl Schulen als auch andere Orte genutzt und neben den Schülerinnen und Schülern auch deren Eltern angesprochen.“ Dafür wurden auch andere Kommunikationswege genutzt, so beispielsweise digitale Elternabende veranstaltet. Seit Beginn des Berichtsjahres sind der Agentur für Arbeit Bonn die meisten Stellen zu folgenden Berufsausbildungen gemeldet worden: Kaufmann/-frau im Einzelhandel (320), Kaufmann/-frau Büromanagement (237), Verkäufer/in (230), Medizinische/r Fachangestellter/r (165), Handelsfachwirt/in (145), Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (137), Anlagenmechaniker/in, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (100), Fachkraft – Lagerlogistik (93), Verwaltungsfachangestellte/r Bundesverwaltung (81) und Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik (80). Neu in diesem Ranking sind dabei die Ausbildungen zum Anlagenmechaniker*in an Platz 7, die Verwaltungsfachangestellten an Platz 9und die Elektroniker*in Energie- und Gebäudetechnik auf Platz 10. Mit Stand März 2024 haben 2.644 junge Menschen ihr Interesse an einer Ausbildung signalisiert, aber noch keine Stelle erhalten. Ihnen stünden derzeit2.602 Stellen offen. Mit Blick auf die noch verbleibenden Monate bis zum Beginn des Ausbildungsjahres kalkulieren alle Beteiligten noch mit einer hohen Dynamik: Erfahrungsgemäß steigt das Interesse an Stellen und Vorstellungsterminen erheblich, wenn der Prüfungsstress der Schülerinnen und Schüler vorbei ist und die Noten vorliegen. Dies wird zwischen Mitte April und Mitte Mai der Fall sein. Guter Start ins Ausbildungsjahr 2023/24 aus Sicht der Wirtschaft Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg, ist mit dem Start des Ausbildungsjahres 2023/24 zufrieden. Zum 31.03.2024 waren bei der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 591 Ausbildungsverträge registriert, das sind 65 oder 12,4% mehr als zum Vorjahr (526). Nachwuchssicherung: „Nimm2“Den Unternehmen rät Jürgen Hindenberg: „Die Devise bei den Einstellungsgesprächen der nächsten beiden Auszubildendenjahrgänge sollte ‘Nimm 2‘ lauten. Denn wenn das Land Nordrhein-Westfalen 2025/26 vom achtjährigen auf das neunjährige Abitur umstellt, werden von den Gymnasien in diesem Jahr keine Abiturienten abgehen. Wenn die Betriebe demgegenüber 2024 und 2025 jeweils zwei Auszubildende einstellen, sind sie für das Jahr 2026 besser gerüstet.“ In Zahlen bedeute die Umstellung auf G9 einen Rückgang der Abiturientenzahlen von 111.000 auf 66.000 und bei Schülerinnen und Schülern mit Hochschulreife von allgemeinbildenden Schulen einen Rückgang von 67.000 auf 26.000. Janin Fester, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Bonn • Rhein-Sieg erkennt einen positiven Trend im Handwerk: „Wir können steigende Zahlen bei den Abschlüssen der Ausbildungsverträge bestätigen. Die Steigerungen sind besonders deutlich bei den Anlagenmechanikern und Elektrikern. Um die Klimaziele zu erreichen, benötigen wir als umsetzende Kraft unsere Handwerker.Wir sind froh, dass das Interesse für die Gewerke entsprechend auch gewachsenist. Sorge bereiten uns die Lebensmittelhandwerke – konkret das Bäckerhandwerk und Fleischerhandwerk. Das Handwerk hat sich vielfach modernisiert und dennoch die wertvollen Traditionen nicht verloren. Freie Ausbildungsstellen können noch gefunden werden. Zukunftsweisend lohnt sich eine Ausbildung im Handwerk.“ Berufsorientierungsmesse „Berufsstart 2024“ Die diesjährige Pressekonferenz ist gleichzeitiger Auftakt für die „Berufsstart 2024“, der gemeinsam von Agentur für Arbeit Bonn, IHK und der Kreishandwerkerschaft veranstalteten Berufsorientierungsmesse. Am heutigen 9. und morgigen 10. April erwarten über 100 regionale Arbeitgebende aus Industrie, Handwerk, Gastronomie, Verwaltung, Handel und Dienstleistung von jeweils 13 bis 17:30 Uhr Schülerinnen und Schüler aller Schulformen im Beueler Brückenforum, um ihnen das vielfältige Ausbildungsspektrum der Region vorzustellen. Mit ihrer Ausbildungsbörse machen die Kooperationspartner jungen Menschen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis das Angebot, auf kurzen Wegen unterschiedliche Ausbildungsberufe und Arbeitgeber kennenzulernen. Dabei lohnt sich ein Besuch an beiden Tagen, weil sich jeweils unterschiedliche Unternehmen vorstellen. Ausbildung macht mehr aus unsMit Azubifutter, einer Elternbroschüre sowie Bus-&Bahn-Werbung möchte die IHK mit ihrer Kampagne „Jetzt#könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“ noch mehr Schulabgänger von einer Dualen Berufsausbildung begeistern. Azubis finden mit Unterstützung der IHK-AusbildungsvermittlungDie IHK unterstützt Unternehmen mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Bundesprojekt „Passgenaue Besetzung und Willkommenslosten“ bei der Besetzung von Ausbildungsstellen und informiert auch, wie Auszubildende aus Drittländern, z.B. im Hotel- und Gaststättengewerbe aus Indonesien, angeworben werden können. Elektronischer Datenanhang zum Ausbildungsmarkt Zurück
Lkw-Maut: Möglichkeit zur Voranmeldung der Handwerkerausnahme für Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 7,5 t
By Jürgen Fälchle – Adobe Stock Lkw-Maut: Möglichkeit zur Voranmeldung der Handwerkerausnahme für Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 7,5 t Ab dem 1. Juli 2024 wird die LKW-Maut grundsätzlich auf Lastkraftwagen zwischen 3,5 t und 7,5 t ausgeweitet. Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 t, die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der Fahrer zur Ausübung seines Handwerks benötigt, bleiben jedoch von der Maut befreit (sog. „Handwerkerausnahme“). Ab sofort können Betriebe, die die Voraussetzungen der Handwerkerausnahme erfüllen, ihre Fahrzeuge bei Toll Collect melden. Welche Fahrzeuge fallen unter die Handwerkerausnahme? Die Mautpflicht wird nur relevant, wenn das „Motorfahrzeug“ über 3,5 t technische zulässige Gesamtmasse (tzGm) aufweist. Nur in diesem Fall wird die tzGm eines Anhängers mitgezählt. Die Handwerkausnahme gilt nur bis unter 7,5 t tzGm. Hierzu erklärt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): „Die Handwerkerausnahme gilt, wenn das Fahrzeug (mit mehr als 3,5 und weniger als 7,5 Tonnen technisch zulässige Gesamtmasse) von einer oder einem Mitarbeitenden des Handwerksbetriebs gefahren wird und Material, Ausrüstungen oder Maschinen transportiert werden, die zur Ausführung der Dienst- und Werkleistungen des Handwerksbetriebs notwendig sind, oder wenn handwerklich gefertigte Güter transportiert werden, die im eigenen Handwerksbetrieb hergestellt, weiterverarbeitet oder repariert werden/wurden. Die Voraussetzungen für die Handwerkerausnahme erfüllen alle Berufe, die in den Anlagen A und B der Handwerksordnung aufgeführt sind, sowie in Deutschland anerkannte Ausbildungsberufe, die dem Handwerk zugeordnet sind und deren Tätigkeitsprofil mit dem eines Handwerksberufs vergleichbar ist.“ Auf der Website des Bundesamtes für Mobilität und Logistik (BALM) finden Sie weitere Hinweise. Hier ist auch die nach Angaben des BMDV „abschließende Liste“ der unter die Handwerkerausnahme fallenden Berufe veröffentlicht: Wo kann ich die Vorabbefreiung eintragen? Es gibt für Handwerksbetriebe die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis vorab bei Toll Collect als „mautbefreit“ eintragen zu lassen, um die regelmäßige Zustellung von Klärungsschreiben von „Mautbrücken“ und „Mautsäulen“ zu vermeiden. Zur Eintragung der Vorabbefreiung sind Angaben zum Unternehmensnamen und Sitz, zur Eintragung gemäß den Anlagen der Handwerksordnung A, B1 und B2 sowie zu den auf den Betrieb gemeldeten Fahrzeugen erforderlich. Unabhängig davon muss bei jeder Einzelfahrt die Einhaltung der Voraussetzungen der Handwerkerausnahme gewährleistet sein. Meldeportal von Toll Collect:https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Standardartikel_Buehne/Tonnageabsenkung_und_Handwer-kerausnahme.html https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/anzeige_einer_handwerklichen_taetig-keit/formular_anzeige_handwerkliche_taetigkeit.html#/kundendaten FAQ zur Meldung für die Handwerkerausnahme: https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderun-gen_2023_und_2024/handwerkerfahrzeuge_melden/p1745_faq_meldung_zur_handwerkeraus-nahme.html Wo finde ich weitere Informationen? Auf den Seiten von BALM und Toll Collect sind weitere Informationen und eine erste FAQ veröffentlicht: https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderun-gen_2023_und_2024/handwerkerausnahme/p1745_faq_handwerkerausnahme.html Was muss ich beachten, wenn ich ein Fahrzeug „abgelastet“ habe? Im schon länger mautpflichtigen Gewichtsbereich ab 7,5 t Gesamtmasse gelten seit 1. Dezember 2023 verschiedene Änderungen. Für das Handwerk relevant ist vor allem die Anpassung der Definition der mautrelevanten Gesamtmasse: Im aktuellen Bundesfernstraßenmautgesetzes wird aufgrund europarechtlicher Vorgaben hinsichtlich der Frage, ob ein Fahrzeug mautpflichtig, ist nicht mehr auf die „zulässige Gesamtmasse“ (= „zulässiges Gesamtgewicht (zGG)“) ,sondern auf die „technisch zulässige Gesamtmasse“ (tzGm) abgestellt. Dies kann für einige Handwerksbetriebe Probleme schaffen, die in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen (Führerschein, Geschwindigkeitsbegrenzung etc.) „abgelastet“ und damit die zulässige Gesamtmasse reduziert haben, um unter die Grenze von 7,5 t zu kommen. Soweit es sich dabei um eine rein „formale“ rechtliche Ablastung handelt, wird diese in den Fahrzeugpapieren meist nur unter „F.2: Im Zulassungsmitgliedsstaat zulässige Gesamtmasse in kg“ und nicht unter „F.1: Technisch zul. Gesamtmasse in kg“ eingetragen. Wenn die Modifikation lediglich unter F.2. erfolgte, kann das dazu führen, dass einzelne Betriebe seit Gültigkeit des Gesetzes in die Mautpflicht fallen, wenn sie nun die Grenze von 7,5 t erreichen oder überschreiten. In diesem Fall wäre bei Fahrten auf mautpflichtigen Strecken die Maut zu entrichten – entweder über das Einschalten bzw. den Einbau einer On-Board-Unit oder durch die Meldung von Einzelstrecken per Internet oder Mautautomaten. Aktuell wird von Prüfinstitutionen (Dekra, TÜV) noch regelmäßig auf Antrag und bei Prüfung typabhängiger Voraussetzungen eine Umtragung der Angaben von F.2 (zulässige Gesamtmasse) in F.1 (tzGm) vorgenommen, insbesondere bei Ablastungen, die nur zu einer geringen Überschreitung der Grenze von 7,5 t führen. Anschließend wäre diese Änderung bei den Zulassungsbehörden zu melden und ggf. die Angaben bei Toll Collect zu modifizieren. In solchen Fällen ist Betrieben zu raten, möglichst zeitnah diese Modifikation in den Fahrzeugpapieren zu prüfen, um Belastungen durch die Maut bzw. Bußgelder zu vermeiden Zurück
Mit dem Handwerk die Zukunft gestalten!
Von industrieblick – Adobe Stock Mit dem Handwerk die Zukunft gestalten! Ausbildungsappell von ZDH-Präsident Dittrich anlässlich der ab dem 11. März bundesweit stattfindenden „Woche der Ausbildung“ der Allianz für Aus- und Weiterbildung unter dem diesjährigen Motto „Zukunft will gelernt sein“: Wer im Handwerk anpackt, der macht die Zukunft des Landes: Klimaschutz und Nachhaltigkeit, kreative Gestaltung und technische Lösungen, Lebensqualität für Menschen allen Alters und aller Vielfalt: Das alles leistet das Handwerk. Die duale Ausbildung ist Startpunkt für eine Bildungskarriere mit Sinn, Sicherheit und Zukunft. Deshalb rufen wir alle Jugendlichen auf: Wenn Ihr Zukunft gestalten wollt, dann liegt Ihr mit einer Ausbildung im Handwerk genau richtig! Informations- und Orientierungsangebote wie der „Berufe-Checker“ zeigen, welcher Ausbildungsberuf im Handwerk am besten zu Euren Talenten, Fähigkeiten und Vorlieben passt. Die digitalen Informations- und Orientierungsangebote sowie die persönlichen Ansprechpartnerinnen und -partner von Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften vor Ort unterstützen Euch bei der Suche und Auswahl des Ausbildungsbetriebes, der zu Euch passt. Nutzt die Chance, schnuppert mit Praktika Handwerksluft und lasst Euch für eine Ausbildung begeistern. Und das nicht morgen, sondern bereits heute: Der ideale Zeitpunkt, um den Grundstein für Eure eigene Karriere zu legen, ist jetzt! Die Betriebe rufen wir auf, ihre Werkstatttüren weit zu öffnen: Geben Sie jungen Menschen die Chance, mit einer Ausbildung in Ihrem Betrieb durchzustarten! Wer seinen Fachkräftenachwuchs durch die Ausbildung im eigenen Betrieb gewinnt, sichert sich motivierte, engagierte und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bieten Sie jungen Menschen dafür Praktika an, um sie vom Handwerk zu begeistern. Und nutzen Sie Angebote von Handwerkskammern wie die Lehrstellenbörsen, um ihre Angebote bekannter zu machen. Über Unterstützungsmöglichkeiten und Förderinstrumente während der Ausbildung informieren wir Sie auch digital. Jede erfolgreiche Ausbildung ist ein Gewinn für die Handwerksfamilie: Die Handwerksorganisationen stehen Euch und Ihnen bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe zur Seite. Ausbildung lohnt sich – für Jugendliche wie Betriebe! Quelle: ZDH –https://www.zdh.de/presse/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/mit-dem-handwerk-die-zukunft-gestalten/ Zurück
Mit Abitur glücklich und erfolgreich im Handwerk
Mit Abitur glücklich und erfolgreich im Handwerk. Handwerk? Ist das nicht nur etwas für Haupt- und Realschüler/-innen? Falsch gedacht! Auch für Abiturient/-innen bietet das Handwerk attraktive Karrieremöglichkeiten. Das erkennen immer mehr junge Menschen. Heute ist der Abiturientenanteil im Handwerk mehr als 20 % höher als noch vor fünf Jahren. Und die Abiturientinnen und Abiturienten, die sich für das Handwerk entscheiden, sind mit ihrer Berufswahl besonders zufrieden. Stehst auch du kurz vor dem Abitur oder hast es frisch in der Tasche und fragst dich jetzt: Hörsaal oder Praxis? Dann lass dich von den Beraterinnen und Beratern der Handwerkskammer in deiner Region unterstützen. Sie können dir dabei helfen, den passenden Ausbildungsplatz zu finden, oder beraten dich über die Möglichkeiten, die Ausbildung zu verkürzen. Denn als Abiturient/-in kannst du deine Ausbildung in zwei statt drei Jahren absolvieren. Studieren kannst du nach der Ausbildung selbstverständlich immer noch – und dir Teile deiner Ausbildung dann gegebenenfalls auch wieder auf dein Studium anrechnen lassen. Ansprechpartner/-innen vor Ort finden. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Handwerkskammer deiner Region stehen dir bei allen Fragen persönlich zur Seite. Los geht’s Deine Karrieremöglichkeiten. Wenn du nach deiner Ausbildung noch einen Meisterbrief machst, hast du sogar einen Abschluss in der Tasche, der mit einem Bachelor gleichgestellt ist – und bist auch beim Gehalt auf Augenhöhe. Mit dem Meisterbrief kannst du außerdem einen eigenen Betrieb gründen oder einen bestehenden Handwerksbetrieb übernehmen. Viele erfolgreiche Betriebe suchen in den kommenden Jahren altersbedingt Nachfolger/-innen. Deine eigene Chefin oder dein eigener Chef sein – klingt das nicht spannend? Du kannst dir ein Studium grundsätzlich vorstellen, möchtest aber nicht den ganzen Tag über Büchern brüten? Dann könnte ein duales oder triales Studium das Richtige für dich sein.Beim dualen Studium absolvierst du die handwerkliche Ausbildung parallel zum Bachelor. Und während andere beim Berufseinstieg der Praxisschock erwischt, weißt du schon, worauf es im Arbeitsalltag ankommt, und legst einen super Karrierestart hin. Mit dem trialen Studium setzt du noch einen oben drauf und sahnst gleich drei Abschlüsse ab: den Abschluss in deinem ausgewählten Ausbildungsberuf, einen Bachelorabschluss im Studienfach und einen Meisterbrief im Ausbildungsberuf. Und das in nur 4,5–5 Jahren. Quelle:https://www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/bewerbungs-und-karrieretipps/angebote-fuer-abiturienten Zurück

Unterwegs für „Kein Abschluss ohne Anschluss“Ausbildungsbotschaftende NRW
Unterwegs für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ Ausbildungsbotschaftende NRW Berufsorientierung und Nachwuchsmarketing auf Augenhöhe mit den Ausbildungsbotschaftern Die Zahl der freien Ausbildungsplätze im Handwerk steigt an und es können schon lange nicht mehr alle besetzt werden. Ferner verlassen viele Jugendliche die Schule ohne konkreten Berufswunsch und streben immer seltener in eine Ausbildung. Die hervorragenden Beschäftigungsperspektiven und Aufstiegschancen nach Abschluss einer dualen Ausbildung sind oft zu wenig bekannt. Um dem entgegenzuwirken und eine Ausbildung im Handwerk attraktiver zu machen, bietet die Handwerkskammer zu Köln mit unseren Ausbildungsbotschaftenden einen Peer-to-Peer Ansatz an, bei dem Auszubildende, Schülerinnen und Schülern an Schulen und Berufskollegs über ihre gesammelten Erfahrungen während ihrer Ausbildung sowie über Karrieremöglichkeiten informieren. Nutzen des Projekts: Für Handwerksbetriebe: Gewinnung der Fachkräfte von morgen gezielte Ansprache potentieller Bewerber/- innen Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung als engagierte/-r Ausbilder/-innen und Arbeitgeber/-innen wahrgenommen werden Für Auszubildende: stärken ihre persönlichen Kompetenzen stellen ihre fachliche Kompetenz unter Beweis erhalten eine Schulung und eine Urkunde (offizielle Verleihung) Für Schüler/innen: bekommen Impulse für die eigene Berufsorientierung erhalten weitere Perspektiven nach dem Schulabschluss gewinnen authentische und realistische Einblicke in die Berufe erhalten eine Teilnahmebescheinigung (für den Berufswahlpass) Unserer Aufgabe besteht darin Auszubildende zu gewinnen und in einer eintägigen Schulung fortzubilden. Sowie die Koordination der Einsätze zwischen Betrieb und Schule (Anzahl und Schulform frei wählbar). Downloads pdfRückmeldebogen_2023 (846kB) pdfEinwilligungserklärung Ausbildungsbotschafter (102kB) pdfFlyer_Ausbildungsbotschaftende_NRW (5854kB) Kontakt: Anna-Sophia Brandhorst Karrierecoachin Heumarkt 12 50667 Köln Tel. +49 221 – 2022 482 Dipl.-Hdl. Tanja Heinsberg Karrierecoachin Heumarkt 12 50667 Köln Tel. +49 221 – 2022 403 Zurück

Auszubildende bleiben immer öfter ihrem Ausbildungsbetrieb treu
Auszubildende bleiben immer öfter ihrem Ausbildungsbetrieb treu Anlässlich der am 14. September veröffentlichten Studie des IAB zum Verbleib von Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen des Handwerks in ihrem Ausbildungsbetrieb erklärt ZDH-Generalsekretär Schwannecke: „Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dass es Handwerksbetrieben zunehmend besser gelingt, ihre Auszubildenden nach der Abschlussprüfung dauerhaft an den Betrieb zu binden. Diese Ergebnisse des Ausbildungspanel Handwerk vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) sind zugleich für Betriebe ermutigend, sich dafür zu entscheiden, die eigenen künftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb auszubilden. Zahlreiche Betriebe handeln bereits danach und nutzen bewusst die duale Ausbildung, um den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern. Die Verbleibquote im Betrieb weist demnach keine Unterschiede zwischen Ausbildungsabsolventen mit oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit auf oder zwischen Absolventinnen mit Hauptschul- oder Realschulabschluss. Das unterstreicht die hohe Integrationsleistung einer erfolgreich abgelegten handwerklichen Berufsausbildung. Im Handwerk gibt es aktuell noch über 31.000 offene Ausbildungsplätze, das sind tausendfach ungenutzte Bildungs- und Karrierechancen für junge Menschen. Um die Handwerksbetriebe bei ihrer Fachkräftenachwuchssicherung zu unterstützen, muss die berufliche Ausbildung gestärkt und politisch endlich Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer gleichwertigen Behandlung beruflicher und akademischer Ausbildung führen. Dabei muss sich die Bundesregierung der im jüngsten OECD-Bildungsbericht für Deutschland festgestellten „Bildungspolarisierung“ aktiv stellen. Besonders an Gymnasien erfahren junge Menschen noch viel zu selten von den vielfältigen Handwerksberufen, den möglichen Bildungsabschlüssen und Karriereoptionen bis hin zu Unternehmensgründungen und Betriebsübernahmen. Daher müssen Bund und Länder die Berufsorientierung stärken und an allen allgemeinbildenden Schulen und gerade auch an Gymnasien die Informationen über die Optionen der beruflichen Bildung stets zu einem festen Bestandteil der Berufsorientierung machen. Hierbei gilt es, die Wirtschaft und das Handwerk vor Ort stärker einbeziehen. Mit Blick auf leistungsschwächere Jugendliche müssen die Unterstützungsangebote, die es im Ausbildungsbereich gibt, bei Kleinst- und Kleinbetrieben, Ausbildungsinteressierten und Auszubildenden besser bekannt gemacht werden. Die Instrumente ‚Einstiegsqualifizierung‘ und ‚Assistierte Ausbildung flexibel (AsAflex)‘ müssen flächendeckend angeboten und verstärkt beworben werden.“ Quelle: https://www.zdh.de/presse/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/auszubildende-bleiben-immer-oefter-ihrem-ausbildungsbetrieb-treu/ Zurück
Startschuss für klimafreundliches Heizen: Bundestag beschließt Novelle des Gebäudeenergiegesetzes
Startschuss für klimafreundliches Heizen: Bundestag beschließt Novelle des Gebäudeenergiegesetzes Einleitung Der Bundestag hat heute die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Das Gesetz ist der Startschuss für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren Energien. Es leitet eine umfassende Modernisierung der Wärmeversorgung in Deutschland ein: Mit mehr Fernwärme und effizienterer, sparsamerer und klimafreundlicher Heiztechnologie geht damit die Wärmepolitik in Deutschland nach Jahren des Stillstandes auf einen zukunftsfähigen Kurs. Verbraucherinnen und Verbraucher, Wohnungswirtschaft, Heizungsindustrie und Handwerk haben mit den neuen Regelungen eine klare Richtschnur für ihre Investitionsentscheidungen. So können Erneuerbare Energien im Gebäudebereich zum Standard werden und Schritt für Schritt klimaschädliche Heizungen auf Basis von Erdgas oder Erdöl ersetzen. Klimaschutz und Energiesicherheit kommen mit diesem Gesetz Jahr für Jahr verlässlich voran. Damit beim Umstieg auf eine zeitgemäße Heizung niemand überfordert wird, gibt es ausreichende Übergangsfristen sowie Härtefallregelungen und eine Förderung für den Heizungstausch von bis zu 70%. Die Fristen harmonieren mit den geplanten Vorgaben für die Erstellung von Wärmeplänen nach dem Wärmeplanungsgesetz. Eigentümerinnen und -Eigentümer können beim Umstieg auf erneuerbare Energien frei zwischen unterschiedlichen Technologien wählen. Bestehende Öl- und Gasheizungen sind nicht von der Regelung betroffen und können weiter genutzt werden. Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck: „Wir haben monatelang intensiv über dieses Gesetz debattiert, und die vielen Diskussionen und Gespräche haben dieses Gesetz besser gemacht. Nun können wir sagen: Das Gesetz ist eine zentrale Weichenstellung für den Klimaschutz. Wir werden unabhängiger von fossiler Energie und stärken so die Energiesicherheit. Wir schützen Verbraucherinnen und Verbraucher vor steigenden Preisen für Erdgas und Erdöl. Und wir setzen einen Impuls für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei grünen Technologien. Zentral ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger bei den anstehenden Investitionen mit unserer Förderung unter die Arme greifen, so dass sie sich den Umstieg leisten können. Es gibt in Zukunft bis zu 70% Förderung für den Heizungstausch, um insbesondere Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen zu unterstützen. Das ist wichtig.“ Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz: „Nach den intensiven Diskussionen der letzten Monate um das sog.„Heizungsgesetz“ freue ich mich, dass dieses heute vom Deutschen Bundestag beschlossen worden ist und im Ergebnis ein wirklich gutes Gesetz geschaffen wurde. Es bringt uns dem Ziel der Klimaneutralität 2045 ein gutes Stück näher, ohne dabei die Eigentümer und Mieter zu überfordern. Das Gesetz bietet echte Technologieoffenheit. Durch die Verknüpfung mit der kommunalen Wärmeplanung gibt es den Gebäudeeigentümern die Möglichkeit, sich bei der Entscheidung für eine klimafreundliche Heizung an den Inhalten der Wärmepläne zu orientieren und schafft so nach und nach Planungs- und Investitionssicherheit. In Verbindung mit den erweiterten gesetzlichen Erfüllungsoptionen und den großzügigen Übergangsfristen hat jeder Gebäudeeigentümer die Möglichkeit, die für ihn passende und sachgerechte Option zur Erfüllung der 65% EE-Vorgabe zu wählen, egal, ob er auf dem Land oder in der Stadt wohnt.“ Kurzüberblick zum Gesetz: In Neubaugebieten muss ab dem 1.1.2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% erneuerbare Energie nutzen. Für Bestandsgebäude und Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, gilt diese Vorgabe abhängig von der Gemeindegröße nach dem 30.06.2026 bzw.30.06.2028. Diese Fristen sind angelehnt an die im Wärmeplanungsgesetz vorgesehenen Fristen für die Erstellung von Wärmeplänen. Ab den genannten Zeitpunkten müssen neu eingebaute Heizungen in Bestandsgebäuden und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten die Vorgaben des Gesetzes erfüllen. Um es den Eigentümern zu ermöglichen, die für sie passendste Lösung zu finden, kann für eine Übergangsfrist von fünf Jahren noch eine Heizung eingebaut werden, die die 65% EE-Vorgabe nicht erfüllt. Bestehende Heizungen sind von den Regelungen nicht betroffen und können weiter genutzt werden. Auch wenn eine Reparatur ansteht, muss kein Heizungsaustausch erfolgen.Der Umstieg auf Erneuerbare erfolgt technologieoffen. Bei einem Heizungseinbau oder -austausch können Haus-Eigentümer frei unter verschiedenen Lösungen wählen: Anschluss an ein Wärmenetz, elektrische Wärmepumpe, Stromdirektheizung, Biomasseheizung, Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel), Heizung auf der Basis von Solarthermie und „H2-Ready“-Gasheizungen, also Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es einen rechtsverbindlichen Investitions- und Transformationsplan für eine entsprechende Wasserstoffinfrastruktur vor Ort gibt. Daneben ist jede andere Heizung auf der Grundlage von Erneuerbaren Energien bzw. eine Kombination unterschiedlicher Technologien zulässig. Dann ist ein rechnerischer Nachweis für die Erfüllung des 65%-Kriteriums zu erbringen.Um auch bei Öl- und Gasheizungen, die ab dem 1.1.2024 eingebaut werden, den Weg Richtung klimafreundliches Heizen einzuschlagen, müssen diese ab dem Jahr 2029 stufenweise ansteigende Anteile von grünen Gasen oder Ölen verwenden: Ab dem 1.1.2029 15 %, ab dem 1.1.2035 30 % und ab dem 1.1.2040 60 %. Das Gebäudeenergiegesetz enthält weitere Übergangsregelungen, z.B. wenn der Anschluss an ein Wärmenetz in Aussicht steht, und eine allgemeine Härtefallregelung, die auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht ermöglicht. Im Einzelfall wird dabei etwa berücksichtigt, ob die notwendigen Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag oder in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Auch Fördermöglichkeiten und Preisentwicklungen fließen hier ein. Aber auch aufgrund von besonderen persönlichen Umständen, wie etwa einer Pflegebedürftigkeit, kann eine Befreiung von der Pflicht zum Heizen mit Erneuerbaren gewährt werden. Für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren gibt es finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen, Krediten oder steuerlicher Förderung. So sind bis zu 70% Förderung möglich. Alle Antragstellenden können eine Grundförderung von 30% der Investitionskosten erhalten. Haushalte im selbstgenutzten Wohneigentum mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 40.000 Euro erhalten noch einmal 30% Förderung zusätzlich (einkommensabhängiger Bonus). Außerdem ist für den Austausch alter Heizungen ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von 20% bis 2028 vorgesehen, welcher sich ab 2029 alle 2 Jahre um 3 Prozentpunkte reduziert. Die Boni sind kumulierbar bis zu einer maximalen Förderung von 70%.Zusätzlich ist neu ein Ergänzungskredit für Heizungstausch und Effizienzmaßnahmen bei der KfW erhältlich, bis zu einem Jahreshaushaltseinkommen von 90.000 Euro zinsverbilligt. Sonstige energetische Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin mit 15% (bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans mit 20%) Investitionskostenzuschuss gefördert. Auch die Komplettsanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden auf ein Effizienzhaus-Niveau sowie alternativ die steuerliche Förderung bleiben unverändert erhalten.Dazu wird jetzt die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) novelliert und soll gemeinsam mit dem GEG zum 1.1.2024 Inkrafttreten. Durch die weitreichende Förderung des Heizungsaustauschs werden auch die Mieterinnen und Mieter vor hohen Mietsteigerungen geschützt, denn die Fördermittel müssen von den Kosten der Modernisierungsmaßnahme

Arbeitsagentur verleiht Zertifikate an lokale Ausbildungsbetriebe 2022/2023
Teilnehmer*innen der Verleihung der Ausbildungszertifikate am 6. September 2023 – (Foto: AA Bonn) Arbeitsagentur verleiht Zertifikate an lokale Ausbildungsbetriebe 2022/2023 Am Mittwoch, den 06. September 2023 erhielten vier Betriebe aus dem Wirtschaftsraum Bonn/Rhein-Sieg das Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit, welches das besondere Engagement bei der Berufsausbildung von Jugendlichen auszeichnet. In einer Zeit des Wandels und der Herausforderungen eröffnet eine Ausbildung eine sichere Perspektive für zukünftige Fachkräfte. Denn eine qualifizierte Ausbildung ist ebenso der Schlüssel für individuelles Wachstum und den Erfolg der Wirtschaft.Dabei fehlen vielen Betrieben die Bewerberinnen und Bewerber. Die Zahlen sind seit Jahren rückläufig und auch die Betriebe melden aktuell deutlich weniger Ausbildungsstellen als im Vorjahr. Das verschärft den hiesigen Fachkräftemangel.Wichtiger denn je ist es daher, junge Menschen und Betriebe frühzeitig zusammenzubringen. Stellvertretend für alle Betriebe, die sich dem betrieblichen und sozialen Engagement der dualen Berufsausbildung widmen, wurde den anwesenden Betrieben das Ausbildungszertifikat der Bundesagentur für Arbeit für herausragende Nachwuchsförderung verliehen. Janin Fester – Kreishandwerkerschaft Bonn•Rhein-Sie Aus dem Handwerk erhielten in diesem Jahr die Haarbörse Stefanie Orth aus Hennef und die Firma Matthias Both und Sohn GmbH aus Bad Hönningen das Ausbildungszertifikat. Aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg wurden die Franz-Peter Vendel GmbH & Co. KG aus Bornheim und die Firma Kuchem Konferenz Technik GmbH & Co. KG aus Königswinter für ihr Engagement bei der Ausbildung geehrt. Die Verleihung fand in den Räumen des Studio 7 der Kuchem Konferenz Technik GmbH und Co. KG in Königswinter statt.Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn sagte: „Die berufliche Ausbildung unseres Nachwuchses ist ein Fundament für unsere Gesellschaft. Es kann nicht hoch genug bewertet werden, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Aufgabe verschreiben und dem Thema Nachwuchsförderung eine hohe Priorität einräumen.Diese Unternehmen will die Agentur für Arbeit sichtbar machen und auszeichnen. Es braucht Menschen mit genau dieser Haltung!“Die Haarbörse Stefanie Orth „Ich habe das allerbeste Team um mich, und hier im Kreise von so tollen Unternehmen geehrt zu werden, macht mich sehr stolz,“ sagte Stefanie Orth. Matthias Both und Sohn GmbH zeigt, dass auch in der 5. Generation der Schlüssel zum erfolgreichen Fortbestehen in der Aus- und Weiterbildung liegt.Franz-Peter Vendel GmbH & Co. KG „Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen den ansässigen Betrieben, der Bundesagentur für Arbeit und der IHK Bonn/Rhein-Sieg schaffen wir es, junge Menschen wieder für das Thema Ausbildung zu begeistern und das Fundament im Personalwesen für die Zukunft zu sichern“ sagte Geschäftsführer Jan Buchholz. „Als Betrieb der auf den eigenen Nachwuchs großen Wert legt, fühlen wir uns durch das Zertifikat zur Nachwuchsförderung besonders geehrt.Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und der IHK Bonn/Rhein-Sieg haben diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt“, teilte Björn Müller, Geschäftsführer der Kuchem Konferenz Technik GmbH & Co. KG mit. Mit Janin Fester, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg, Jürgen Hindenberg Geschäftsführer Berufsausbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Roberto Lepore, Abteilungsleiter für berufliche Orientierung/Kar- rierewerkstatt der Handwerkskammer zu Köln nahmen traditionell auch drei wichtige Partner der Arbeitsagentur an der Verleihung teil.Janin Fester erklärte: „Wir freuen uns, dass ein Innungsbetrieb aus dem Handwerk das Ausbildungszertifikat erhalten hat und gratulieren allen Betrieben zur Auszeichnung. Die Ausbildung ist die Basis und die Zukunft des Handwerks. Nachhaltigkeit fängt bereits dort an. Es werden Fachkräfte ausgebildet, welche nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch die Zukunft des Gewerkes sichern. Zudem wird die Region dadurch ge- stärkt. Wir sind überzeugt, dass die Anerkennung durch das Ausbildungszertifikat moti- vierend wirkt und das eingebrachte Engagement durch die Auszeichnung ansprechend gewürdigt wird.“„In der heutigen Zeit, wo wir Schwierigkeiten haben alle unsere Ausbildungsplätze zu besetzen, zeigen die Unternehmen, die heute von der Agentur für Arbeit geehrt wurden, dass Fachkräftesicherung bei A wie Ausbildung beginnt“, sagte Jürgen Hindenberg. „Die Zukunftsaussichten der dualen Berufsausbildung waren selten so gut wie heute. Eine Ausbildung im dualen System legt die Basis für eine echte Berufs- und Bildungskarriere. Mit mehr als 350 Ausbildungsberufen existieren für jede und jeden unterschiedlichste Möglichkeiten, seine Talente und Fähigkeiten einzubringen, sich vielfältige Kenntnisse anzueignen, neue Ideen zu entwickeln und durchzustarten. Ohne das ungebrochene Engagement unserer Ausbildungsbetriebe wäre dies allerdings nicht möglich. Gerade die hier und heute zertifizierten Ausbildungsbetriebe haben es über mehrere Jahrzehnte verstanden, vorbildlich und erfolgreich junge Menschen auszubilden, Wissen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben und sich damit sich der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu stellen. Die Handwerkskammer zu Köln gratuliert allen Beteiligten für diese außerordentliche Leistungen“, äußerte sich Roberto Lepore. Mich beeindruckt das Engagement aller ausgezeichneten Ausbildungsbetriebe und ihre Einstellung bzw. ihr Bewusstsein, dass das höchste Gut ihrer Unternehmen die Mitarbeitenden sind. Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis dürfen zurecht Stolz auf diese Unternehmen sein“, so Bernd Lohmüller, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bonn. Bei jedem Schritt gibt es Unterstützung, vor Ort und digital. Für eine gelungene und nachhaltige Berufswahl sollten die Jugendlichen die Angebote der Berufsberatung nutzen. Zu einer individuellen Förderung oder finanziellen Unterstützung können Ausbildungsbetriebe mit den Arbeitgeber-Services Kontakt aufnehmen.Kontaktmöglichkeiten: Arbeitgeber*innen:Freie oder wieder frei gewordene Ausbildungsstellen nimmt die Agentur für Arbeit unter der Arbeitgeber-Hotline 0800 / 4 5555 20 entgegen. Jugendliche:Jugendliche, die bisher noch keinen Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit hatten, erreichen die Kolleginnen und Kollegen unter: Bonn: Telefon (02 28) 924 8000E-Mail: : Telefon (0 22 41) 300 800E-Mail: Angebote erreichen Jugendliche über die Seite:https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen Zurück
MOBILITÄTSWENDE VERSTEHEN & ERLEBEN – Am 29. September in und um die Stadthalle Troisdorf
INTERKOMMUNALER MOBILITÄTSTAG Informieren. Kommunizieren. Ausprobieren. 29.09.2023 Sehr geehrte Damen und Herren, am 29.09.2023 veranstalten die Kommunen Siegburg, Sankt Augustin, Lohmar, Königswinter und Bonn, sowie der Rhein-Sieg-Kreis den 2. Interkommunalen Mobilitätstag (IMT) in der Stadthalle Troisdorf und dem Open.Air Platz. Wir starten um 09:00 Uhr mit der Eröffnung des IMT durch die Bürgermeister*innen und dem Landrat der ausrichtenden Kommunen und des Rhein-Sieg-Kreises. Frau Sylvia Lier wird die Keynote zu „Flexible Mobilitätslösungen aus einer Hand – wie kann das gelingen“ halten. Es folgen zweimal sechs parallel laufende „Crash-Kurse“ à 45 Minuten zu verschiedenen Themen der betrieblichen Mobilität. Nach der Podiumsdiskussion mit Verkehrsminister Oliver Krischer, Prof. Dr. Stephan Wimmers (IHK BN/RS), Rob Schaap (Mobilitätsmakler, u.a. Projektleiter JOBWÄRTS) und einer weitere/n Teilnehmer*in von 12:15-13:00 Uhr. Anschließend gibt es einen weitere Slot mit weiteren sechs „Crash-Kursen“. Neben dem kompakt vermittelten Wissen in den „Crash-Kursen“ wird auf der Aktivfläche ausprobiert (Pendlerräder, Lastenräder, E-Scooter, etc.). Auf der Mini-Messe bieten Unternehmen, Verbände und Agenturen viele Informationen rund um die Themen betriebliches Mobilitätsmanagement, Dienstradleasing, ÖPNV-Ticket, Fuhrparkoptimierung, u.v.m. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.interkommunaler-mobilitätstag.de oder der LinkedIn Seite https://www.linkedin.com/company/interkommunaler-mobilit%C3%A4tstag/ oder der Veranstaltungsseite https://www.linkedin.com/events/7038849111382478848/comments/ Anmeldungen zu den Crash-Kursen sind unter https://beteiligung.nrw.de/portal/troisdorf/beteiligung/themen/1002294 möglich. Zurück

VORFAHRT VERNUNFT – Kampagne für bessere Mobilität in Bonn/Rhein-Sieg
Die Initiatoren und Unterstützer: (v.l.) Oliver Krämer, Dr. Hubertus Hille, Thomas Radermacher, Christian Faßbender, Stephanie Barfrede, Dirk Vianden, Mathias Johnen, Karina Kröber, Siwar Racho, Stefan Hagen und Jannis Vassiliou.Foto: (c) Bonn.digital / Marc John VORFAHRT VERNUNFT – Kampagne für bessere Mobilität in Bonn/Rhein-Sieg Zu viele Staus, zu wenig Baustellen-Koordination, eingeschränkte Erreichbarkeit von Gewerbestandorten, fehlende Ladezonen – das sind aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft die drängendsten Verkehrsprobleme in der Region. Deshalb geben die Wirtschaftsorganisationen in Bonn/Rhein-Sieg den Startschuss zu einer breit angelegten Verkehrskampagne mit dem Slogan „VORFAHRT VERNUNFT“. Zu den Initiatoren zählen die Kreishandwerkerschaft Bonn‧Rhein-Sieg, Industrie- und Handels-kammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, Handwerkskammer zu Köln, Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen und City-Marketing Bonn. Vorfahrt Vernunft soll den Blick von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit auf die schwierige Verkehrssituation lenken und Verbesserungen für die regionale Wirtschaft erzielen. „Die Kampagne richtet sich ausdrücklich nicht gegen eine Verkehrswende, sondern steht für eine Verkehrswende, aber durchdacht“, teilen die Initiatoren mit. Und weiter: „Wir wollen durch vernünftige und konstruktive Vorschläge erreichen, dass weniger Staus entstehen, Baustellen besser koordiniert und Liefer- und Ladezonen ausgeweitet werden.“ In der kommenden Zeit machen die Initiatoren von Vorfahrt Vernunft mit einer eigenen Website (www.vorfahrt-vernunft.de), Großplakaten und Plakaten in Schaufenstern, Aufklebern auf Autos, Anzeigenwerbung und Social-Media-Posts auf ihr gemeinsames Anliegen aufmerksam. Erst im Frühjahr 2023 zeigte eine breit angelegte Umfrage der Kreishandwerkerschaft und der IHK bei ihren Mitgliedern, wie groß die Unzufriedenheit inzwischen ist. So haben sich für 73 Prozent der Betriebe die Verkehrsbedingungen für Pkws und Lkws in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert. Über vier von fünf Betrieben sind jedoch auf Pkws angewiesen und können nicht auf andere Verkehrsmittel ausweichen. 40 Prozent befürchten Einkommenseinbußen wegen der Verkehrslage, für sieben Prozent ist die Situation sogar existenzbedrohend. „Für die Wirtschaft ist die Erreichbarkeit der Unternehmensstandorte und der Kunden ein wesentlicher Standortfaktor“, argumentiert IHK-Präsident Stefan Hagen bei der Vorstellung der Kampagne. „Für viele Betriebe, etwa Transport- und Logistikunternehmen, Speditionen, Lieferdienste oder Handwerksbetriebe, ist der Einsatz von Kfz schlicht alternativlos.“ Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher sagt: „Die Unternehmen benötigen für ihre Fahrten zu Geschäften, Betrieben und Kunden immer mehr Zeit, finden häufig keinen Parkplatz oder müssen Strafzettel in Kauf nehmen.“ Folgen wie verzögerte Lieferungen, höhere Preise und abgelehnte Aufträge seien längst für Betriebe, Kunden und Geschäftspartner spürbar. Die Kampagne „VORFAHRT VERNUNFT“ rückt insbesondere vier Verkehrsprobleme in den Mittelpunkt, unter denen die Wirtschaft besonders leidet: Staus, Baustellen, Parkflächen und Ladezonen. Beispiel Baustellen: „Wir sprechen uns für den Erhalt, den Ausbau und die Instandhaltung von Verkehrswegen aus“, betonen die Initiatoren. Dies gehe zwangsläufig mit Baustellen einher. Aber: „Viele Einschränkungen sind planbar. Es bedarf einer deutlich besseren Koordination.“ Und weiter: „Bypässe müssen offengehalten oder eingerichtet werden, um das Verkehrsnetz zu entlasten.“ Beispiel Staus: Um das durch ständige Staus belastete Bonner Verkehrsnetz zu entlasten, plant die Stadt unter anderem ein Radverkehrsnetz samt Vorrangrouten. Beispielsweise wird diskutiert, die Adenauerallee von zwei auf eine Fahrspur für Pkws pro Richtung zu verengen. Die jeweils freiwerdende Spur soll in sogenannte „Protected Bike Lanes“ verwandelt werden. Dieser Vorschlag ist aus Sicht der Initiative nicht ausgereift. „Dem Pkw- und Lkw-Verkehr wird immer mehr Raum auf den Hauptverkehrsstraßen entzogen, ohne dass Alternativen geschaffen werden. Darunter leidet die Stabilität des Verkehrsnetzes. „Wir befürworten grundsätzlich ein Radwegenetz in Bonn. Dieses sollte jedoch von den Pkw-Hauptverkehrsstraßen entkoppelt sein.“ Zudem sollte es nicht nur Vorrangrouten für Fahrräder geben, sondern auch Vorrangrouten für Pkws und Lkws. Sollte sich der Stadtrat für einen Verkehrsversuch auf der Adenauerallee entscheiden, ist es für die Initiatoren zentral, dass die regionale Wirtschaft einbezogen wird. Dazu gehören Fragen zur Planung, Umsetzung und Erfolgsmessung. „Transparenz und Dialog sollten in diesem Prozess oberstes Gebot sein“, so die Initiatoren abschließend. Initiatoren und Unterstützer Name Vorname Institution Racho Siwar Taxi Bonn eG Faßbender Christian Fassbender Tenten GmbH & Co.KG Blömer Philipp Blömer am Markt GmbH & Co.KG Vianden Dirk Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg Vassiliou Jannis Einzelhandelsverband Bonn – Rhein-Sieg- Euskirchen e.V. Rademacher Thomas KHW-Kreishandwerksmeister Krämer Oliver KHW-Hauptgeschäftsführer Barfrede Stephanie HWK-Geschäftsführerin Kröber Karina City-Marketing Bonn e.V. Johnen Mathias DEHOGA Nordrhein Hagen Stefan Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg Hille Dr. Hubertus Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg Zurück

Topp-Neubau für „überaus moderne Kreishandwerkerschaft“
Bild: v.l. Architekt, Achim Becker, Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher, Präsident der Handwerkskammer zu Köln, Hans Peter Wollseifer, Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann, Hauptgeschäftsführer Oliver Krämer© Arne Schröder, Handwerkskammer zu Köln Topp-Neubau für „überaus moderne Kreishandwerkerschaft“ Ein freigeräumtes Grundstück mit einer ausgehobenen Grube in einem Teilbereich, ein großer Kran und andere Baumaschinen zeigen an der Ecke Alleestraße/Wilhelmstraße in Siegburg, dass dort etwas Neues entsteht. „Endlich!“, seufzten jetzt Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher und die Festgäste der Kreishandwerkerschaft Bonn/ Rhein-Sieg bei der Grundsteinlegung für das neue Gebäude. Es soll drei Geschosse haben plus einem Staffelgeschoss mit einem multifunktionalen Veranstaltungssaal und in eineinhalb Jahren dem regionalen Handwerk zur Verfügung stehen. Bis dahin, so war der allgemeine Wunsch während der Grundsteinlegung, solle der Bauverlauf aber möglichst problemloser sein als die bisherige Planungs- und Genehmigungsphase. Immerhin zwei Jahre hatte es gedauert, bis der letzte Stempel auf die Unterlagen gedrückt worden war – viel länger als zunächst gedacht. Das habe, so stellte Radermacher klar, jedoch nicht an den Ämtern der Stadt oder des Kreises gelegen. Die hätten sich im Gegenteil „durch viel Kooperationsbereitschaft ausgezeichnet. Die Fußfesseln und Absurditäten unseres Baurechts sind an diesem Drama schuld. Da zweifelt man sehr oft am gesunden Menschenverstand und muss hinnehmen, dass die ursprüngliche Kalkulation ins Rutschen kommt“. Folge von letzterem ist für die Kreishandwerkerschaft, dass sie trotz eigentlich gesicherter Finanzierung auf die zunächst vorgesehene Tiefgarage verzichten wird. So soll die Investitionssumme von 15 Millionen Euro eingehalten werden. Radermacher lobte unter anderem die Obermeister der Innungen für ihren Einsatz pro Neubau und die ersten „Ankermieter“: Die IKK und die Signal Versicherung werden in das Erdgeschoss des Neubaus einziehen. Insgesamt gehe mit dem Projekt der lange gehegte Wunsch der Kreishandwerkerschaft in Erfüllung, in eigenen Räumlichkeiten zu arbeiten und dann auf eine topp-moderne technische Ausstattung zurückgreifen zu können. Diese, so ergänzte der Präsident der Handwerkskammer zu Köln, Hans Peter Wollseifer, würden demnächst optimal zu der „überaus leistungsfähigen und modernen Kreishandwerkerschaft“ passen. Auch Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann freute sich schon über den neuen Akzent, den die Kreishandwerkerschaft an dieser „zentralen Ecke unserer Stadt setzt, eine Ecke, an der sich schon jetzt viel tut und in den kommenden Jahren noch mehr tun wird“. Radermacher, Wollseifer, Rosemann, Hauptgeschäftsführer Oliver Krämer und der beauftragte Architekt, Achim Becker, füllten der Tradition folgend einen silbernen Zylinder mit tagesaktuellen „Erinnerungsstücken“, darunter Münzen, Visitenkarten, einer Zeitung und Fotos. Der Zylinder wurde anschließend symbolisch in den Grundstein des Neubaus platziert, damit er dereinst der Nachwelt Informationen über den Bauherren und die vergangene Zeit geben kann. Impressionen Bilder: © Arne Schröder, Handwerkskammer zu Köln Zurück

Betriebliche Krankenversicherung – Trumpf im Wettrennen um Fachkräfte
Mit ihrer betrieblichen Krankenversicherung gibt die SIGNAL IDUNA dem Handwerk im Wettrennen um qualifizierte Fachkräfte einen starken Trumpf in die Hand. Bild: Von imagesourcecurated @elements.envato.com Diesen nutzen immer mehr Betriebe! Seit 2015 hat sich die Zahl der Unternehmen und Betriebe, die mit einer bKV in die Gesundheit der eigenen Mitarbeitenden investieren, mehr als vervierfacht. Ende 2021 waren es laut Verband der Privaten Krankenversicherung bereits rund 18.200. Denn das Konzept zahlt sich aus und bietet für Arbeitgeber und deren Beschäftigte zahlreiche Vorteile. Neu bei SIGNAL IDUNA: Die betriebliche Krankenversicherung mit frei wählbarem Budget Im Herbst 2022 brachte SIGNAL IDUNA mit drei Budget-Varianten und optimierten Bausteintarifen in der bKV die neue Produktlinie „+“ auf den Markt. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitenden Budgethöhen zwischen 300 und 1.500 Euro zur Verfügung stellen, die sie nach eigenen Wünschen für beispielsweise ambulante und zahnärztliche Leistungen einsetzen können. Bei Bedarf können auch höhere Leistungen für Zahnersatz und weitere Bausteine für eine bessere Versorgung im Krankenhaus sowie Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit ergänzt werden. Klingt interessant? Die Fachberaterinnen und Fachberater der Gebietsdirektion Köln der SIGNAL IDUNA beraten Sie gerne persönlich oder online wie Sie in Ihrem betrieb eine betriebliche Krankenversicherung einsetzen können. Einfach per Mail bei anfragen oder hier einen Termin buchen:https://www.signal-iduna.de/geschaeftskunden-termin.php SCAN ME Zurück
Im Handwerk hauptberuflich Klima schützen
Im Handwerk hauptberuflich Klima schützen Schon jetzt arbeiten in knapp 30 Gewerken täglich Handwerkerinnen und Handwerker in fast allen Bereichen am Erfolg der Energiewende mit, erläutert ZDH-Präsident Jörg Dittrich im Gespräch mit Anne Roßius von „abi.de“. Vor welchen Herausforderungen steht das Handwerk derzeit insgesamt? Eine Karriere im Handwerk ist sinnstiftend, zukunftssicher und bietet ein großes Maß an Freiheit. Dennoch blieben 2022 allein im Handwerk rund 19.000 von den Betrieben angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt. Den Bedarf an Fachkräften zu decken und genügend junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen, ist deshalb die größte Herausforderung, vor der das Handwerk steht, aber auch die Gesellschaft insgesamt – wegen der zentralen und unverzichtbaren Rolle von Handwerkerinnen und Handwerkern für die großen Transformationsaufgaben unseres Landes etwa beim Klimaschutz oder der Wärme- und Energiewende. Der Wille in den Betrieben ist da: Ihr Ausbildungsengagement ist ungebrochen und im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen überdurchschnittlich hoch. Was jedoch fehlt, sind interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Das liegt vor allem auch daran, dass Schülerinnen und Schüler – vor allem an Gymnasien – während ihrer gesamten Schullaufbahn kaum Berührungspunkte mit handwerklichen Berufen haben und sie immer noch dazu Infos erhalten, welche Berufe sie mit einem Studium ausüben können. Über die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk bei den Berufen selbst, aber auch bei den Bildungsabschlüssen bis hin zu Unternehmensgründungen und Betriebsübernahmen werden sie häufig gar nicht oder nur unzureichend informiert. Dabei ist gerade im Handwerk eine steile Bildungskarriere möglich – und das vor allem auch schon sehr jung. Wo sonst kann man schon mit Anfang 20 seinen eigenen Betrieb führen? Wer sich also beruflich und persönlich entwickeln möchte, wer eigene Ideen verwirklichen möchte, egal ob als eigene Chefin und eigener Chef oder für einen Betrieb, der ist im Handwerk genau richtig! Das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Damit junge Menschen überhaupt erfahren, welche Welten sich im Handwerk für sie auftun, muss die Berufsorientierung an allen Schulformen ausgebaut werden und die Information über die berufliche Bildung zum festen Bestandteil der Berufsorientierung werden. Das gilt vor allem für Gymnasien. Denn qualifizierte Fachkräfte werden händeringend gesucht im Handwerk: Bereits heute sind rund 250.000 Stellen für handwerkliche Fachkräfte offen. Und der Bedarf wird sicherlich wegen der anstehenden Transformationen weiter steigen. Deshalb braucht es zunächst eine Bildungswende, damit genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, um die Energiewende erfolgreich umzusetzen: Wir müssen hinkommen zu einer echten Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung in finanzieller und ideeller Hinsicht. Welche Handwerksberufe sind für die Energiewende relevant? Von Beruf Klimaschützer? Im Handwerk ist das möglich. Schon jetzt arbeiten fast 3,1 Millionen Beschäftigte in rund 490.000 Handwerksbetrieben und in knapp 30 Gewerken täglich in fast allen Bereichen am Erfolg der Energiewende mit. Sie dämmen Gebäude, machen die Stromnetze für die Mobilität der Zukunft stark oder stellen die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen um. All das spart CO2 und bringt Deutschland seinen Klimazielen näher. In folgenden Gewerken im Handwerk werden klimarelevante Tätigkeiten ausgeübt: Behälter- und Apparatebauer Brunnenbauer Dachdecker Elektromaschinenbauer Elektrotechniker Estrichleger Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Glaser Installateur und Heizungsbauer Kälteanlagenbauer Klempner Kraftfahrzeugtechniker Land- und Baumaschinenmechatroniker Maler und Lackierer Maurer und Betonbauer Metallbauer Ofen- und Luftheizungsbauer Raumausstatter Rollladen- und Sonnenschutztechniker Schornsteinfeger Straßenbauer Stuckateure Tischler Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer Werkstein- und Terrazzohersteller Zimmerer Zweiradmechatroniker Sind die Herausforderungen des Handwerks in diesen Berufen noch stärker spürbar? Wie viele Fachkräfte fehlen derzeit? Allein wegen der Planungen zum Wärmepumpenausbau gehen wir davon aus, dass im Bereich Sanitär-Heizung-Klima bis 2030 rund 60.000 zusätzliche Monteure gebraucht werden. Doch der Fachkräftebedarf ist in allen Gewerken hoch, bei den Klima- und Energiegewerken, aber ebenso bei den Nahrungsmittel-, Gesundheits- und allen anderen Gewerken: Handwerk sichert die Versorgung der Menschen in Stadt und Land mit den unterschiedlichsten Produkten und Leistungen und ist damit für das tägliche Leben unverzichtbar. Und Fachkräfte werden für die Gestaltung von anstehenden Transformationsprozessen gebraucht. Insofern werden im Handwerk Fachkräfte überall und in jedem Gewerk gesucht, die Berufs- und Karrierechancen sind hervorragend. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Nachwuchs für das Handwerk gewinnen. Dafür müssen aber wieder mehr junge Menschen die Werkbank dem Hörsaal vorziehen. Wir als Handwerk tun mit unseren Nachwuchsinitiativen und -kampagnen bereits das unsere, um für Nachwuchs zu sorgen. Nun sind Politik und Gesellschaft gefragt: Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, die der gleichermaßen großen Bedeutung von beruflicher und akademischer Bildung Rechnung tragen, und Politik muss beide Bildungswege gleichwertig fördern und finanziell ausstatten. Und in der Gesellschaft braucht es ein Umdenken dahingehend, dass Wissen und Können gleichermaßen notwendig und wichtig sind, damit unser Land funktioniert und wir Zukunft gestalten können. Welche Berufschancen hätte ein junger Mensch, der sich für eine Ausbildung im Energiebereich entscheidet? Wer sich für eine Karriere im Handwerk entscheidet, setzt auf Sicherheit, einen guten Verdienst bereits in jungen Jahren und darauf, ganz egal in welchem Gewerk, gebraucht zu werden und damit gesellschaftlich relevant zu sein. Im Energiebereich sind Handwerkerinnen und Handwerker vor allem im Hoch- und Tiefbausektor sowie in der Gebäude- und in der Versorgungstechnik tätig und folglich auch ganz besonders gefragt. Welche Karrieremöglichkeiten hat man im Handwerk? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Die Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk sind so vielfältig, wie die Gewerke selbst. Die berufliche Bildung bietet eine große Vielfalt an Abschlüssen, Fortbildungen und Qualifizierungen. Für alle Interessen, für jede Lebensphase ist etwas dabei. Die Vielfalt an Möglichkeiten wird bei der Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen allerdings nicht ausreichend kommuniziert. Der klassische und häufigste Karriereweg ist der Gesellen- und danach der Meisterabschluss mit der Chance, einen eigenen Betrieb zu gründen oder einen bestehenden Betrieb zu übernehmen. In den kommenden fünf Jahren stehen allein im Handwerk rund 125.000 Betriebsübergaben an. So jung wie im Handwerk besteht in kaum einem anderen Wirtschaftsbereich die Möglichkeit, seine eigene Chefin oder sein eigener Chef zu sein und damit einhergehend eigene Wünsche und Ideen zu verwirklichen. Bereits zwischen Gesellen- und Meisterabschluss sind zusätzliche Fortbildungen möglichen. Man kann sich beispielsweise zum Berufsspezialisten weiterentwickeln, etwa zum Servicetechniker oder zum Fachmann oder zur Fachfrau für kaufmännische Betriebsführung im Handwerk. In vielen Gewerken kann auch der Meisterabschluss um Fortbildungen aufgestockt werden: auf der Ebene des Bachelor Professional beispielsweise zum Verkaufsleiter oder zur Verkaufsleiterin
Meisterprämie startet in Nordrhein-Westfalen
Meisterprämie startet in Nordrhein-Westfalen Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: Ab 1. Juli 2023 können frischverbriefte Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister erstmals eine Meisterprämie beantragen: Wer die finanziellen und zeitlichen Anstrengungen unternimmt und eine Aufstiegsfortbildung im Handwerk erfolgreich abschließt, kann sich nun über eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 2.500 Euro freuen. Mit der Meisterprämie soll dem bestehenden Fachkräftemangel im Handwerk entgegengewirkt werden. Denn neben der Zahl der Auszubildenden ist auch die Zahl der abgeschlossenen Meisterprüfungen seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2002 wurden laut der Statistik des Westdeutschen Handwerkskammertags in Nordrhein-Westfalen noch 4.706 Meisterprüfungen erfolgreich abgeschlossen, 2022 waren es nur noch 3.760 Prüfungen. „Bei den Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern handelt es sich um jene Gruppe, die entscheidend für die Zukunft ihrer Zunft, für die Unternehmensnachfolge und -gründung und damit für den Erhalt und die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Handwerk ist“, führt Arbeitsminister Karl-Josef Laumann aus: „Daher wollen wir für engagierte Gesellinnen und Gesellen einen Anreiz setzen, sich auf den Weg zur Meisterprüfung zu begeben. Insbesondere vor dem Hinter-grund der Energiewende sind wir auf gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker zwingend angewiesen. Auch aus diesem Grund hat die Landeregierung entschieden, eines der ersten Fachkräfteprogramme dieser Legislatur im Bereich Handwerk umzusetzen.“ Kontinuierliche Qualifizierung ist sowohl für die berufliche Perspektive des Einzelnen als auch für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wichtig. Für die Meisterprämie sind daher im aktuellen Haushalt 5,5 Millionen Euro und in den kommenden Jahren jeweils elf Millionen Euro reserviert. Hierdurch können jedes Jahr weit über 4.000 Meisterinnen und Meister ausgezeichnet werden. Die Meisterprämie ist ein Baustein der nordrhein-westfälischen Fachkräfteoffensive. Die Fachkräftesicherung ist eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre und dieser Legislaturperiode. Schon jetzt ist die Situation in vielen Branchen und Regionen äußerst angespannt. Auch der demografische Wandel wird sich in den nächsten zehn Jahren besonders erkennbar machen. Mit der Fachkräfteoffensive NRW tritt die Landesregierung im Schulterschluss mit Unternehmen, Kammern, Verbänden, Sozialpartnern sowie der Arbeitsverwaltung diesen Entwicklungen geschlossen entgegen. Wer kann die Prämie beantragen?Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister mit einem Abschluss in einem Gewerbe nach Anlage A oder B Abschnitt 1 der Handwerksordnung, die ihre Prüfung ab dem 1. Juli 2023 erfolgreich bestanden haben und ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben, können eine Meisterprämie erhalten. Anträge sind über die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) zu stellen. Das Antragsformular und alle wichtigen Informationen zum Antragsverfahren finden Sie unter www.meisterprämie.nrw. Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Zurück
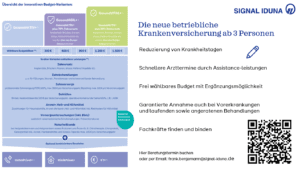
Die neue betriebliche Krankenversicherung ab 3 Personen
Mail an Frank Bergemann Die neue betriebliche Krankenversicherung ab 3 Personen Reduzierung von Krankheitstagen Schnellere Arzttermine durch Assistance-leistungen Frei wählbares Budget mit Ergänzungsmöglichkeit Garantierte Annahme auch bei Vorerkrankungen und laufenden sowie angeratenen Behandlungen Fachkräfte finden und binden Hier Beratungstermin buchen oder per Email: Zurück

Die Wirtschaft sieht beim Verkehr rot – Umfrage zur Verkehrssituation in der Region von IHK und Kreishandwerkerschaft
Die Wirtschaft sieht beim Verkehr rot Umfrage zur Verkehrssituation in der Region von IHK und Kreishandwerkerschaft Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK) und die Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg (KHS) haben gemeinsam unter ihren Mitgliedern eine Umfrage zur Verkehrssituation in der Region durchgeführt. Gegenstand der Befragung ist, wie sich die Verkehrswende auf Unternehmen und Handwerksbetriebe in der Region auswirkt.„Unsere aktuelle Verkehrsumfrage zeigt, dass der Großteil der Betriebe mit der Verkehrssituation in der Region und der Entwicklung in den letzten Jahren sehr unzufrieden ist. Leider sieht die Wirtschaft bei diesem Thema rot“,so Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg.Als Interessensvertretung der regionalen Wirtschaft fordern IHK und KHS daher eine wirtschaftsfreundlichere Umsetzung der Verkehrswende und eine gleichberechtigte Verbesserung bei allen Verkehrsmitteln durch Ausbau.Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass nicht alle Wirtschaftsverkehre von der Straße auf andere Verkehrsmittel verlagert werden können.Bekräftigt wird diese Forderung durch die Umfrageergebnisse. 73 Prozent der befragten Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk sind der Meinung, dass sich die Situation für Pkw und Lkw in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat. Diese Ergebnisse sind besorgniserregend, weil gleichzeitig 82 Prozent der Unternehmen diesen Verkehrsmitteln eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für ihre eigenen betrieblichen Abläufe beimisst.Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher ergänzt: „Besonders für das Handwerk ist die Situation gravierend. Die meisten Mitarbeitenden können beruflich weder auf den ÖPNV ausweichen noch im Homeoffice arbeiten. Zudem sind frei zugängliche Lade-, Liefer- und Parkzonen für den wirtschaftlichen Erfolg äußerst wichtig. Der Werkstattwagen muss in unmittelbarer Nähe zum Kunden abgestellt werden können.“ Die Umfrage zeigt auch, dass 40 Prozent der Unternehmen aufgrund der Verkehrslage künftig eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation befürchten.Entspannung erhoffen sich rund 63 Prozent der Betriebe durch den Ausbau des ÖPNV, der zu Entlastungen auf den Straßen sorgen würde. Würden Pendler vermehrt auf das Fahrrad oder den ÖPNV setzen, könnte der Verkehrsfluss für motorisierte Wirtschaftsverkehre verbessert werden. Knapp die Hälfte der Befragten traut der Politik jedoch nicht zu, diese Lösung auch tatsächlich umzusetzen.„Auch wir sind für die Verkehrswende. Sie sollte aber vernünftig und durchdacht angegangen werden und vor allem die regionale Wirtschaft im Blick behalten“, so Radermacher und Hagen. „Bereits begonnene Maßnahmen müssen kontinuierlich evaluiert, auf Verhältnismäßigkeit geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Zudem ersetzt dies nicht notwendige Ausbauvorhaben, diese müssen ebenfalls vorangetrieben werden.“An der Umfrage, die im Februar und März 2023 durchgeführt wurde, beteiligten sich 1.300 Betriebe. Präsentation zur Verkehrsumfrage PDF Zurück
Fokus auf Elektro-Nutzfahrzeuge: Land stellt 90 Millionen Euro für die Antriebswende bereit
Fokus auf Elektro-Nutzfahrzeuge: Land stellt 90 Millionen Euro für die Antriebswende bereit Ministerin Neubaur: Wir senken Emissionen und unterstützen die klimafreundliche Weiterentwicklung des Verkehrssektors Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 2023 den Umstieg auf Elektromobilität mit rund 90 Millionen Euro. Förderschwerpunkt des Programms progres.nrw – Emissionsarme Mobilität ist in diesem Jahr der Bereich Nutzfahrzeuge: Zuschüsse gibt es unter anderem für den Aufbau und Netzanschluss von Ladestationen für gewerblich genutzte Fahrzeuge sowie für Konzepte zur Beschaffung und zum wirtschaftlichen Einsatz von batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 2023 den Umstieg auf Elektromobilität mit rund 90 Millionen Euro. Förderschwerpunkt des Programms progres.nrw – Emissionsarme Mobilität ist in diesem Jahr der Bereich Nutzfahrzeuge: Zuschüsse gibt es unter anderem für den Aufbau und Netzanschluss von Ladestationen für gewerblich genutzte Fahrzeuge sowie für Konzepte zur Beschaffung und zum wirtschaftlichen Einsatz von batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen. Kommunen erhalten zudem Unterstützung bei der Anschaffung von Elektro-Nutzfahrzeugen. Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Nordrhein-Westfalen ist ein starker Wirtschaftsstandort und ein Verkehrsknotenpunkt im Zentrum Europas – und damit ganz automatisch auch ein Schwerpunkt für den Güterverkehr. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Emissionen im Verkehrssektor jetzt zügig und deutlich zu senken. Mit dem Fokus des Förderprogramms auf dem Ausbau betrieblicher Schnellladepunkte schaffen wir wichtige Grundlagen für die breite Nutzung von E-Nutzfahrzeugen und tragen zur klimafreundlichen Weiterentwicklung des Verkehrssektors bei.“ Neben der Förderung für Nutzfahrzeuge unterstützt das Land erstmals auch den Ausbau des Ladenetzes an Carsharing-Stationen. Zur Entlastung des öffentlichen Ladenetzes sind zudem Ladestationen für Beschäftigte und Mietende weiterhin förderfähig. Als Alternative zum Auto erhalten Gewerbetreibende und Handwerker Zuschüsse für Lastenfahrräder. Das Land Nordrhein-Westfalen setzt mit progres.nrw – Emissionsarme Mobilität eines seiner erfolgreichsten Klimaschutz-Förderprogramme fort. Im Jahr 2022 wurden Vorhaben mit einem Volumen von rund 70 Millionen Euro gefördert. So sind allein 21.500 neue Ladepunkte entstanden, 500 davon öffentlich zugänglich. Hinzu kamen rund 400 öffentlich zugängliche Schnellladepunkte. Zudem förderte das Land die Beschaffung von 1.300 Fahrzeugen, die mit einer Batterie oder mit einer Brennstoffzelle angetrieben werden. Etwa 730 werden in Kommunen und deren Betrieben eingesetzt, bei den restlichen Fahrzeugen handelt es sich um Nutzfahrzeuge für Unternehmen und Gewerbetreibende. Darüber hinaus wurde über das Landesprogramm der Kauf von rund 2.400 Lastenfahrrädern unterstützt. Übersicht der aktuellen Fördergegenstände: Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Gewerbetreibende: Neben der Fortführung der Förderung von Ladeinfrastruktur für Beschäftigte und Mietende (Pauschalförderung von maximal 1.000 Euro je Ladepunkt) wird nun auch die Errichtung von Schnellladeinfrastruktur für gewerbliche Fahrzeuge unterstützt. Unternehmen und Gewerbetreibende erhalten für Ladepunkte mit einer Ladeleistung von mindestens 50 Kilowatt eine Förderung von bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis maximal 15.000 Euro je Ladepunkt. Ein eventuell erforderlicher Stromanschluss an das Mittelspannungsnetz wird ebenfalls mit 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis maximal 100.000 Euro unterstützt. Ladeinfrastruktur für Carsharing-Stationen: Erstmals werden jetzt gezielt Ladepunkte an Carsharing-Stationen gefördert. Unternehmen erhalten bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, bis maximal 1.500 Euro je Ladepunkt. Netzanschlusskosten bis 15.000 Euro sind ebenfalls förderfähig. Stromnetzanschlüsse für Stellplätze: Der Anschluss an das Stromnetz stellt häufig einen hohen Kostenfaktor bei der Errichtung von Ladepunkten dar. Stromnetzanschlüsse für bestehende Garagen- und Stellplatzkomplexe sind jetzt auch für bereits elektrifizierte Grundstücke förderfähig. Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge für Kommunen: Die bisher erfolgreiche Fahrzeugförderung für Kommunen wird um Nutzfahrzeuge der Fahrzeugklassen N2 und N3 erweitert, die in nicht wirtschaftlichen Bereichen der Kommunen eingesetzt werden. Die Förderhöhe beträgt 80 Prozent der Investitionsmehrkosten für die Beschaffung von batterieelektrischen oder brennstoffzellenbasierten Fahrzeugen. Die Förderung beträgt maximal 400.000 Euro je Fahrzeug. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite von ElektroMobilität NRW. Quelle:https://www.land.nrw/pressemitteilung/fokus-auf-elektro-nutzfahrzeuge-land-stellt-90-millionen-euro-fuer-die Zurück
Elf Millionen Euro jährlich für Meisterprämie im Handwerk
Ab Mitte des Jahres 2023 wird das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Meisterprämie in Höhe von 2.500 Euro für jede erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Handwerk zahlen. Die Fachkräfteoffensive der Landesregierung startet schwungvoll: Ab Mitte des Jahres 2023 wird das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Meisterprämie in Höhe von 2.500 Euro für jede erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Handwerk zahlen. Hierfür nimmt das Land – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags – jedes Jahr elf Millionen Euro in die Hand. „Mit der Meisterprämie investieren wir in kluge Köpfe und die Attraktivität der Beruflichen Bildung. Das ist sehr gut angelegtes Geld. Denn: Um klimaneutral zu werden, reicht es nicht, sich hehre Ziele auf Klimakonferenzen zu setzen. Die Transformation zur Klimaneutralität muss ganz konkret umgesetzt werden. Dafür brauchen wir Menschen, die anpacken und mithelfen. In den kommenden Jahren werden viele Betriebsinhaber und Meisterinnen und Meister im Handwerk altersbedingt ausscheiden. Mit der Meisterprämie wollen wir einen Anreiz setzen, den anspruchsvollen Weg einer Meisterfortbildung zu gehen. Perspektivisch können wir damit auch wertvolle Arbeitsplätze und Ausbildungsbetriebe erhalten und die Gründung neuer Betriebe überhaupt ermöglichen“, erklärt Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Die konkrete Ausgestaltung der Meisterprämie wird derzeit erarbeitet. Der Beginn der Förderung ist für Mitte 2023 geplant und wird sich an Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister nach Anlage A und B 1 zur Handwerksordnung richten. Die Prämie wird nach erfolgreich bestandener Prüfung gewährt und in einem möglichst unkomplizierten Verfahren ausgezahlt werden. Laumann: „Eine Meisterfortbildung ist nicht nur fachlich und zeitlich anspruchsvoll, sondern ist auch für viele Teilnehmende ein finanzieller Kraftakt. Denn während das Studium in der Regel kostenlos ist, müssen angehende Meisterinnen und Meister nach wie vor einen Teil ihrer Fortbildungskosten selber schultern. Auch hier wollen wir mit der Meisterprämie einen Beitrag zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung leisten. Denn wir wollen Berufsbildungsland Nummer Eins werden!“ Hintergrund Fachkräfteoffensive Die Landesregierung hat eine Fachkräfteoffensive gestartet, um mit neuen, verbesserten und verstetigten Angeboten und Kooperationen, dem akuten und drohenden Fachkräftemangel zu begegnen. Besondere Engpässe werden im Bereich der beruflichen Ausbildung erwartet. Allein in den kommenden zehn Jahren werden über eine Million Erwerbstätige altersbedingt ausscheiden, der Großteil auf Facharbeiterniveau. Die Attraktivität der beruflichen Bildung ist deshalb ein zentrales Handlungsfeld der Fachkräfteoffensive. Mit der Meisterprämie im Handwerk setzt die Landesregierung eine erste Zusage des Koalitionsvertrages zügig um. Zahlen, Daten, Fakten Handwerk Im Handwerk in Nordrhein-Westfalen sind 2022 derzeit 1,18 Millionen Menschen beschäftigt – rund ein Prozent weniger als noch 2021 2022 wurde 28.000 Ausbildungsverträge im Handwerk neu abgeschlossen – rund fünf Prozent weniger als vor der Pandemie Rund 21 Prozent der Beschäftigten im Handwerk gehen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand Jeder fünfte Betriebsinhaber im Handwerk ist über 60 Jahre alt 2021 wurde 3.546 erfolgreiche Meisterprüfungen abgelegt. 2001 waren es noch 4.724 Prüfungen. Quelle: https://www.land.nrw/pressemitteilung/elf-millionen-euro-jaehrlich-fuer-meisterpraemie-im-handwerk Zurück

„Ausbildung als Hebel gegen den Fachkräftemangel –Duale Ausbildung als Chance für beruflichen Erfolg wahrnehmen.“
„Ausbildung als Hebel gegen den Fachkräftemangel – Duale Ausbildung als Chance für beruflichen Erfolg wahrnehmen.“ Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt in Bonn•Rhein-Sieg 2022/2023 Die Agentur für Arbeit Bonn, die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK) und die Kreishandwerkerschaft Bonn•Rhein-Sieg präsentierten in ihrer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag, den 31. März 2023, die Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt des Berufsberatungsjahres 2022/23 für die Region. Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn, sagt: „Den Wandel hin zu einem Bewerber*innen-Markt spüren wir immer deutlicher. Für die Betriebe wird es immer schwerer, die jungen Menschen von sich zu überzeugen. Bei mehr als 300 dualen Ausbildungsmöglichkeiten und fast 16.000 Bachelor- und Masterstudiengängen ist es wichtig, die Jugendlichen gut zu beraten und Orientierung zu bieten. Das ist der Schlüssel für die richtige Berufswahl und einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben.“ Akquise von Ausbildungsstellen Die Agentur für Arbeit konnte seit Beginn des Berichtsjahr 3.128 Ausbildungsstellen akquirieren. Das sind -339 oder -9,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl gemeldeter Bewerber*innen sank ebenfalls zum Vorjahr um -217 (-6,4 Prozent) auf insgesamt 3.151. Der erneute Rückgang der Bewerber*innen für eine duale Ausbildung liegt im Agenturbezirk unter anderem daran, dass viele Jugendliche tendenziell ihren Schulbesuch fortsetzen, um einen höheren Schulabschluss zu erlangen. Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn•Rhein-Sieg empfiehlt den Schülerinnen und Schülern ihre Chancen zu nutzen – ihm sei keine einzige Branche bekannt, in welcher jetzt nicht auch noch Auszubildende gesucht würden. Aus Erfahrung wisse er, dass ein Praktikum der beste Weg ist, um Unternehmen zu überzeugen und motiviert daher: „Bewerbt euch jetzt um ein Praktikum“. Bewerber*innen empfiehlt er darüber hinaus die besonde-ren Beratungsleistungen der IHK, insbesondere die von der Bundesregierung mitgeförderten Projekte „Passgenaue Besetzung“ oder „Willkommenslotsen“. (www.ihk-bonn.de, Webcode: @2124, @3990) Seit Beginn des Berichtsjahres sind der Agentur für Arbeit Bonn die meisten Stellen zu den folgenden Berufsausbildungen gemeldet worden: Kaufmann/-frau im Einzel-handel (229), Kaufmann/-frau Büromanagement (218), Verkäufer/in (191), Medizi-nische/r Fachangestellter/r (155), Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (137), Handelsfachwirt/in (97), Fachinformatiker/in – Systemintegration (75), Bankkaufmann/- frau (68), Kfz. Mechatroniker/in (63) und Fachkraft – Lagerlogistik (62). Für Jugendliche ist es sehr wichtig, dass sie sich auf viele gute Ausbildungsangebote bewerben können. Für viele Betriebe ist die Berufsausbildung ein wichtiges Instrument, um ihren Bedarf an Fachkräften zu decken. Dem Fachkräftebedarf durch die eigene Ausbildung zu begegnen, ist immer noch der Königsweg. Jürgen Hindenberg ergänzt zu den Ausbildungszahlen der Agentur für Arbeit: „Auch wir registrieren immer noch einen Rückgang von 4,31% Ausbildungsverträgen (510 Verträge/ -22 Verträge) zum Vorjahr. Wir stellen jedoch fest, dass es genügend Ausbildungsplätze gibt, um allen Bewerber*innen ein Angebot auf Ausbildung zu machen.“ Weiterhin informieren die Kooperationspartner zu den Herausforderungen, die den Ausbildungsmarkt der Region prägen. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist auch weiterhin durch Passungsprobleme gekennzeichnet. Sowohl das Angebot an Ausbildungsplätzen als auch die Nachfrage nach Lehrstellen waren rückläufig. Hinzu kommt, dass die Region Bonn•Rhein-Sieg ein starker Studienstandort ist. Es besteht die Neigung der jungen Menschen, einen höheren Schulabschluss anzustreben oder direkt in ein Studium einzusteigen. Der höchste Anteil an Schulabgängern in der Region besitzt eine Hochschulzugangsberechtigung. Oliver Krämer, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bonn•Rhein-Sieg gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken: „Wir brauchen ganz dringend eine echte Bildungswende hin zu einer gleichwertigen Wertschätzung von beruflicher und akademischer Ausbildung. Eine gleichwertige finanzielle Unterstützung wäre ein erster wichtiger Schritt dahin.“ Stefan Krause zieht insgesamt eine positive Bilanz. „Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt ist die Ausgangsposition für viele Jugendliche so gut wie noch nie. Der Arbeitsmarkt reißt sich um gut ausgebildete junge Menschen. Die Ausbildung ist der stärkste Hebel, die passenden Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen. Viele Unternehmen nehmen diese Botschaft ernst.“ Der Agenturchef gibt zu bedenken: „Schwieriger ist es bei den Jugendlichen, die die Schulzeit ohne einen Abschluss beenden. Jeder junge Mensch ohne Schulabschluss ist einer zu viel.“ Mit einem fehlenden Abschluss sind immer auch schlechtere Zukunftsaussichten für die Betroffenen verbunden. „Um die Chancen der Jugendlichen auf eine Ausbildung zu verbessern, brauche es eine frühe Förderung im Unterricht und einen besseren Informationsaustausch untereinander. Wir müssen gemeinsam darauf hinwirken, dass unsere Berufsberatung leichter und früher mit den Jugendlichen ohne Anschlussperspektive in Kontakt treten kann, um Unterstützung für den Übergang in berufsbildende Maßnahmen anzubieten.“, so Krause. Offene Ausbildungsstellen und unversorgte Bewerber*innen Die Bilanz seit Beginn des Berichtsjahres zeigt, dass auf 1.961 unversorgte Bewerber* innen 2.161 offene Stellen kommen. Auf 100 unbesetzte Berufsausbildungsstellen kommen 91 unversorgte Bewerber*innen. Zum Vorjahr fiel die Anzahl der unversorgten Bewerber*innen um -8,3 Prozent und die der unbesetzten Ausbildungsstellen um -10,9 Prozent. „Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung müssen wir bei jungen Menschen wieder die Lust auf den eigenen Betrieb erhöhen.“, sagt Oliver Krämer. Hierzu ergänzt Dr. Lars Normann, Leiter der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bonn: „Wir erleben aktuell einen immer deutlicheren Wandel hin zum Bewerber* innen-Markt. Dies wird sich zukünftig aufgrund des demografischen Wandels noch fortsetzen. Nun geht es darum zu handeln. Wir wollen möglichst allen jungen Menschen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben ermöglichen und intensivieren hierzu im zweiten Halbjahr nochmals unser Beratungsangebot in den regionalen Schulen.“ Ausblick 2023 Vor kurzem ging die gemeinsame IHK-Kampagne „Ausbildung macht mehr aus uns – Jetzt #könnenlernen“ an den Start. Jugendliche können auf dem Tiktok-Kanal (@DIE.AZUBIS) und der Website den Alltag von acht Azubis verfolgen. „Mit der Kampagne wollen wir zeigen, wie erfolgreich man mit einer dualen Ausbildung sein kann. Und das nicht nur, weil das Lebenseinkommen eines Bachelor Professional (z. B. Fachwirt, Industriemeister) und eines Hochschulbachelors mit 1,4 Millionen Euro vergleichbar ist.“, so Jürgen Hindenberg. „Umwelt- und Klimathemen bewegen Jugendliche gerade mehr als alles andere. Den Jugendlichen sollte dabei bewusst sein: Jeder kann sich für den Klimaschutz aktiv einsetzen. Und zwar hauptberuflich!“, sagt Oliver Krämer. „Der Schlüssel für einen guten Start ins Berufsleben ist gute Beratung und Berufsorientierung. In unserer bundesweiten Aktionswoche Woche der Ausbildung haben wir jungen Menschen und Unternehmen viele tolle Aktionen angeboten um sich zum Thema Ausbildung zu informieren oder auch direkt miteinander in Kontakt zu treten – zum Beispiel in einer zweitägigen Ausbildungsbörse im Brückenforum oder einer Podiumsdiskussion zum Thema „Handwerk und Berufe im Wandel“ in der Bundeskunsthalle.“, so Lars Normann. (Impressionen finden Sie unter: https://berufsberatung-bonn.de/)# Foto AA Bonn: v.l.:
Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen
Heizungsprüfung für Wärmeerzeuger mit Erdgas Zur Vermeidung von Versorgungsproblemen bei Gas und Strom in diesem und im nächsten Winter hat die Bundesregierung ein Energiesicherungspaket beschlossen. Dazu zählt auch die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (kurz EnSimiMaV). Sie ist am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten. Alles Wissenswerte zur „Heizungsprüfung“ Für Sie als Immobilieneigentümer mit zentraler Erdgaswärmeerzeugung schreibt sie eine Prüfung und Optimierung der Anlage vor. Andere Energieträger sind nicht betroffen. Damit soll erreicht werden, dass mehr Gasheizungen effizienter arbeiten. Zu prüfen ist, ob die Heizung hinsichtlich Energieeffizienz optimal eingestellt ist, die Heizung hydraulisch abzugleichen ist, effiziente Heizungspumpen im Heizsystem eingesetzt werden oder Dämmmaßnahmen von Rohrleitungen und Armaturen durchgeführt werden sollten. Zur Optimierung werden folgende Maßnahmen genannt: die Absenkung der Vorlauftemperatur oder die Optimierung der Heizkurve bei groben Fehleinstellungen, die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum Nutzungsprofil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungenoder Abschaltungen der Heizungsanlage und Information des Betreibers,dazu insbesondere zu Sommerabschaltung, Urlaubsabsenkungen,Anwesenheitssteuerungen, die Optimierung des Zirkulationsbetriebs unter Berücksichtigunggeltender Regelungen zum Gesundheitsschutz, die Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berücksichtigunggeltender Regelungen zum Gesundheitsschutz, die Absenkung der Heizgrenztemperatur, um die Heizperiode und -tage zuverringern. Information des Gebäudeeigentümers oder Nutzers über weitergehendeEinsparmaßnahmen. Das Ergebnis der Prüfung wird in einem Bericht festgehalten.Notwendige Optimierungsmaßnahmen sind bis zum 15. September 2024 durchzuführen. Ihre Heizungsfachbetriebe der Innung führen die geforderte Heizungsprüfung gerne für Sie durch, am besten im Rahmen dernächsten Wartung aber auch als gesonderten Termin. Da die genannten Maßnahmen zur Energieeinsparung beitragen, empfehlen wir Ihnen eine zeitnahe Beauftragung.https://shk-bonn-rhein-sieg.de Die Prüfung entfällt in Gebäuden, die im Rahmen eines standardisiertenEnergiemanagementsystems oder Umweltmanagementsystems verwaltet werdenund in Gebäuden mit standardisierter Gebäudeautomation. wenn innerhalb der vergangenen zwei Jahre vor dem 1. Oktober 2022 einevergleichbare Prüfung durchgeführt und kein weiterer Optimierungsbedarf festgestellt worden ist. Der hydraulische Abgleich Abhängig von der Gebäudegröße schreibt die Verordnung einen hydraulischen Abgleich vor. Die Heizungsprüfung kann auch in diesem Rahmen durchgeführt werden.Gaszentralheizungen sind hydraulisch abzugleichen bis zum 30. September 2023a) in Nichtwohngebäuden ab 1.000 Quadratmeter beheizter Fläche(GEG) oderb) in Wohngebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten. bis zum 15. September 2024 in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten. Für Wohngebäude bis 5 Wohneinheiten besteht keine gesetzliche Verpflichtung.Die Verpflichtung entfällt, wenn das Heizsystem in der aktuellen Konfiguration bereits hydraulisch abgeglichen wurde, innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag einHeizungstausch oder eine Wärmedämmung von mindestens 50% derwärmeübertragenden Umfassungsfläche des Gebäudes bevorsteht oderdas Gebäude innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtagungenutzt oder stillgelegt werden soll. Die Studien zeigten, dass durch einen hydraulischen Abgleich ca.10-15% an Energie eingespart werden konnte. Die Verbraucherzentrale empfiehlt diese Maßnahme bereits seit 2002. www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/hydraulischer-abgleich-macht-ihre-heizung-effizienter-30110Den Verordnungstext finden Sie hier:www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.htmlIhr Heizungsfachbetrieb der Innung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Die Verordnung als PDF – Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV) Zurück
Mobile Geräte in der Firma: Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen
MOBILE GERÄTE IN DER FIRMA: LEITFADEN FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN Mobile Geräte sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken, dabei bringt der Einsatz auch einige Risiken mit sich. Mit wenig Aufwand lassen sich allerdings wirksame Strategien entwickeln, um auf Vorfälle wie z.B. den Verlust eines Gerätes vorbereitet zu sein. Die wichtigsten Punkte fassen wir Ihnen hier zusammen! Flyer – PDF – Zurück

Exzellenter Rechtsschutz für Handwerksbetriebe
Exzellenter Rechtsschutz für Handwerksbetriebe Eine Vertragsrechtsschutzversicherung ist essentiell, wenn Sie selbstständig tätig sind. Schnell können aus Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten oder Kunden Rechtsstreitigkeiten entstehen, die vor Gericht landen. Damit Sie nicht auf Anwalts- oder Prozesskosten sitzenbleiben, sind Sie mit der Rechtsschutzversicherung für Handwerksbetriebe der Marke ALLRECHT bestens abgesichert. Mit unserem Produkt „Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Handwerksbetriebe“ erhalten Sie für diese Risiken den passenden Versicherungsschutz. Der Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Handwerkbetriebe der ALLRECHT ist eine moderne und maßgeschneiderte Rechtsschutzlösung. Im Falle eines Rechtsstreits übernimmt die ALLRECHT die oft nur schwer kalkulierbaren Kosten schnell und unkompliziert für Sie. Wir helfen Ihnen damit, Ihr gutes Recht durchzusetzen. Das Leistungsspektrum umfasst Kostenschutz für Streitigkeiten im Bereich Vertrags- und Sachenrecht aus z.B.: Kaufverträgen, Werkverträgen, Werklieferungsverträgen, Wartungsverträgen, Reparaturverträgen, Finanzierungsverträgen und vielen mehr. Der Kostenschutz besteht für Streitigkeiten aus Verträgen nicht nur mit Ihren Kunden, sondern auch mit Lieferanten, Subunternehmen, Kreditinstituten, Herstellern etc. Mit dieser Zusatzversicherung kann der Firmen-Rechtsschutz sinnvoll ergänzt werden, mehr Informationen finden Sie im beigefügten PDF. Oder möchten Sie für eine umfassende Beratung lieber persönlich besprechen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail (frank ) oder rufen uns unter der 0173/4392698 an. PDF Mail an Frank Bergemann Zurück

MdL Oliver Krauß zu Besuch bei der Metzgerei Wolf in Wachtberg
MdL Oliver Krauß zu Besuch bei der Metzgerei Wolf in Wachtberg Am 28. November war Oliver Krauß (CDU), Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags, zu Besuch im Betrieb des Landesinnungsmeisters Adalbert Wolf in Wachtberg bei Bonn. Bei dem Termin anwesend waren auch Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher undHauptgeschäftsführer Oliver Krämer. (Foto von links nach rechts: Thomas Radermacher, Adalbert Wolf, Oliver Krauß, Oliver Krämer.) Der Landesinnungsmeister nutzte die Betriebsbegehung, um die Anliegen und Herausforderungen des Fleischerhandwerks in Nordrhein-Westfalen nochmals der Politik nahezubringen. Gesprochen wurde natürlich zuvorderst von den existenziellen Schwierigkeiten, die die aktuelle Energiepreislage für die fleischerhandwerklichen Betriebe mit sich bringt. Unter Verweis auf den Maschinenpark demonstrierte er, wie energieintensiv eine Metzgerei ist. Insbesondere die Energiekosten für Kühlmaschinen lassen sich aufgrund der Hygiene und Lebensmittelsicherheit nicht nennenswert reduzieren. Desweiteren wurden die Personalsorgen im Fleischerhandwerk thematisiert und diskutiert. Oliver Krauß sagte zu, die Themen im Landtag besprechen und an die Bundespolitik weitergeben zu wollen. v.l.: Thomas Radermacher, Adalbert Wolf, Oliver Krauß, Oliver Krämer Zurück

Jahresbilanz am Ausbildungsmarkt in Bonn•Rhein-Sieg 2021/2022
Jahresbilanz am Ausbildungsmarkt in Bonn/Rhein-Sieg 2021/2022 „Wer mit uns geht, hat gute Chancen anzukommen!“ Bernd Lohmüller, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Bonn, sagt: „Das letzte Berufsberatungsjahr hat gezeigt: Wer mit uns zusammenarbeitet, hat eine große Chance auf Erfolg! Auch wenn das vergangene Jahr weiterhin von den pandemischen Auswirkungen geprägt war, ist es uns gelungen, viele junge Menschen in eine Ausbildung zu vermitteln!“ Der strukturelle Trend auf dem Ausbildungsmarkt schreitet dennoch weiter fort. Die Zahlen der Bewerbenden aber insbesondere der gemeldeten Ausbildungsstellen sinken. Mögliche Gründe hierfür können etwa geänderte berufliche Wünsche von Schulabsolventinnen und Schulabsolventen sein oder, dass die Qualifikationen der Bewerbenden nicht dem Anforderungsprofil der Betriebe entsprechen. Es kann aber auch sein, dass Ausbildungsbetriebe nicht davon ausgehen, Nachwuchskräfte über die Agentur für Arbeit zu finden. Auch wenn der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Preiserhöhungen und insbesondere die unsichere Energieversorgung die wirtschaftliche Entwicklung belasten, werden Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht. Dabei ist die duale Ausbildung die wichtige Säule für die Betriebe zukunftsfähig zu bleiben. Bilanz der Arbeitsagentur Bonn Gemeldete Ausbildungsstellen und Bewerberinnen/Bewerber Die Agentur für Arbeit konnte im zurückliegenden Berichtsjahr 4.538 Ausbildungsstellen verzeichnen. Das sind -288 oder -6,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl gemeldeter Bewerberinnen und Bewerber sank ebenfalls geringfügig zum Vorjahr um -81 (-1,7 Prozent) auf insgesamt 4.671. Der wachsende Bestand an unbesetzten Ausbildungsstellen und die vergebliche Bewerbersuche sind mit die wichtigsten Gründe für Rückgänge in der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung. Hinzu kommen Verunsicherungen am Arbeitsmarkt, die mit Beginn der Covid-19 Pandemie zugenommen haben und durch Materialengpässe, Energiekrise sowie durch die Folgen der EU-weit verhängten umfangreichen wirtschaftlichen Sanktionen in Folge des Ukraine-Kriegs überlagert werden. Der erneute Rückgang der Bewerberinnen und Bewerber für eine duale Ausbildung liegt im Agenturbezirk im Wesentlichen daran, dass junge Menschen Alternativen im tertiären Bildungsbereich, beispielsweise den Besuch einer Fachhochschule, suchen. Viele Jugendliche streben einen höheren Schulabschluss an oder beginnen nach dem Abitur ein Studium. Seit Beginn des Beratungsjahres (1. Oktober 2021) sind der Agentur für Arbeit Bonn die meisten Stellen zu den folgenden Berufsgruppen gemeldet worden: Verkauf (ohne Produktionsspezialisierung) (659), Arzt- und Praxishilfe (536), Büro und Sekretariat (337), Energietechnik (191), Verwaltung (131), Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag (145), Klempnerei, Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik (110), Informatik (115), Speisenzubereitung (101), Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt-, Schiffbautechnik (100). Bernd Lohmüller betrachtet die Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt zuversichtlich. „Mit den verbesserten digitalen Möglichkeiten, der Video-Telefonie und digitalen Veranstaltungsformaten, ist es möglich, auch in Zeiten mit steigenden Infektionen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und sie durchgängig zu beraten. Mit dem einsetzenden Frühjahr 2022 gingen die Infektionen zurück und Beratungen an den Schulen waren wieder realisierbar. Insbesondere durch verstärkte Praktika-Angebote sollte auf den Abschluss von Ausbildungsverträgen hingewirkt werden. Die großartigen Chancen des Ausbildungsmarktes werden wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern aus dem „Bündnis für Fachkräfte“ noch sichtbarer machen. Wer mit uns zusammen geht, hat sehr gute Chancen seine Ziele zu erreichen.“ „Vordergründig kann das Handwerk mit der Entwicklung des Ausbildungsmarkts durchaus zufrieden sein. Wir freuen uns über 1.428 neue Ausbildungsverträge in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Dies entspricht einem Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser positive Trend zeigt sich im gesamten Bezirk der Handwerkskammer zu Köln“, sagt Oliver Krämer, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg. „Trotz Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise lässt sich ein positiver Trend auf dem regionalen Ausbildungsmarkt erkennen. Zum 30. September 2022 wurden bei der IHK Bonn/Rhein-Sieg 2.489 neue Ausbildungsverträge registriert. Das sind 71 Verträge mehr als zum gleichen Stichtag im Vorjahr – ein Zuwachs von immerhin 2,9 Prozent“, so Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Offene Ausbildungsstellen und unversorgte Bewerberinnen/Bewerber Die Bilanz am Ende des Beratungsjahres zeigt, dass auf 196 unversorgte Bewerber 315 offene Stellen kommen. Das bedeutet eine Relation von 1 unversorgten Bewerberin/Bewerber zu 1,6 unbesetzten Berufsausbildungsstellen. Zum Vorjahr fiel die Anzahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber um -28,7 Prozent, dagegen stieg die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen um +54,4 Prozent. „Die Zahlen von unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern und offenen Stellen können natürlich nie eins zu eins aufgehen. Dennoch hat sich der Ausbildungsmarkt in vielen Teilbereichen zu einem Bewerbermarkt gewandelt. In der Folge verändern sich auch die Erwartungen an Unternehmen. Dennoch bietet sich jetzt noch die Chance für Betriebe, ihre offenen Ausbildungsstellen zu besetzen und die eigene Zukunft zu sichern“, so Bernd Lohmüller. „Wir sind für das laufende Ausbildungsjahr vorsichtig optimistisch gestimmt und mit neuem Schwung in den Herbst gestartet.“, so Dr. Lars Normann, Leiter der Berufsberatung. „Soweit wir es jetzt absehen können, verfolgt die Bildungspolitik den Ansatz, die Schulen geöffnet zu lassen. Außerdem haben wir die Impfungen und aus dem Umgang mit dem Covid-19 Virus gelernt. Dies gibt uns die Chance, ohne Unterbrechung im ganzen Schuljahr an Schulen präsent zu sein, um mit guter Beratung mehr Orientierung zu geben und die Jugendlichen auf dem Weg zur erfolgreichen Berufswahl zu begleiten. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, nicht nur den täglichen Beratungen an den Schulen nachzukommen, sondern wieder mehr Präsenzveranstaltungen gestalten und mitgestalten zu können!“ In Hinblick auf die Kammerbilanzen sind folgende Ergebnisse zu nennen: Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg Jürgen Hindenberg sagt: „Über eine Imagekampagne und die Steigerung der Berufsinformationsveranstaltungen an Schulen soll es uns gelingen, mehr Bewerberinnen und Bewerber für das Duale System zu gewinnen. Wir appellieren an die Politik, sich offener als bisher gegenüber Geflüchteten, auch aus Drittstaaten, zu zeigen sowie die Sprachförderung an den Schulen zu stärken. Auch die IHK wird die Schuleinsätze ihrer ehrenamtlichen Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter, ihr Projekt „Passgenaue Besetzung“ sowie das Engagement der Willkommenslotsinnen und -lotsen weiter fortsetzen: Wir brauchen, gerade in diesen Zeiten, Perspektiven für die heimische Wirtschaft!“ Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg „Der positive Trend reicht nicht annähernd aus, um den tatsächlichen Bedarf an Fachkräften in den nächsten Jahren abzudecken. Der Fachkräftemangel ist nach wie vor groß. Betrachtet man die Gesamtsituation, so ist die Entwicklung als sehr alarmierend einzustufen. Das derzeitige Image wird dem Handwerk nicht gerecht. Das Handwerk muss bei der Berufswahl wieder mehr in den Blickpunkt der Jugendlichen, der Eltern und der Lehrer rücken. Es bietet krisensichere Jobs und tolle berufliche Perspektiven,“ so Oliver Krämer. Die Ausbildungsmarktpartner lassen nichts unversucht im neuen Ausbildungsjahr möglichst vielen Jugendlichen eine passende Ausbildung anzubieten.

Kinderfleischwurstpokal 2022
Kinderfleischwurstpokal 2022 Beim Deutschen Fleischer-Verbandstag führte die Fleischerinnung Bonn-Rhein-Sieg ihren bereits traditionsreichen Wettbewerb um den „Kinderfleischwurstpokal“ durch. Dabei beurteilten 20 Kinder unter Anleitung von Obermeister Adalbert Wolf die von Mitgliedern des Präsidiums des Deutschen Fleischerverbandes eingesandten Produkte auf Aussehen, Geruch und Geschmack. Gewinnerin war schließlich Vizepräsidentin Dagmar Groß-Mauer aus Kempenich, die sich riesig über den Pokal freute. Zurück
Inflationsbonus bis 3.000 Euro steuerfrei
Inflationsbonus bis 3.000 Euro steuerfrei Nach dem Corona-Bonus kommt nun die Inflationsausgleichsprämie: Arbeitgeber können ihren Beschäftigten Sonderzahlungen von bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei gewähren – bis Ende 2024 und auch in mehreren Teilzahlungen. Teil des Entlastungspaketes Am 7. Oktober hat der Bundesrat dem vom Koalitionsausschuss vereinbarten dritten Entlastungspaket zugestimmt und so unter anderem der sog. Inflationsausgleichsprämie zugestimmt. Damit können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Arbeitslohn bis zu 3.000 Euro steuerfrei gewähren (§ 3 Nr. 11c EStG). Es handelt sich dabei um einen Freibetrag, bei dem Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Leistung eben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Arbeitgeber können die Prämie bis 31.12.2024 steuerfrei zahlen. Freiwillig und zusätzlich Ähnlich dem Corona-Bonus können Arbeitgeber nun rückwirkend zum 1. Oktober Sonderzahlungen von Steuern und Sozialabgaben befreit an ihre Belegschaft auszahlen – freiwillig und abhängig von der wirtschaftlichen Lage des einzelnen Unternehmens. Wie bei der Corona-Prämie ist die Auszahlung in mehreren Raten möglich. Und auch zu begrüßen, um den Unternehmen die Möglichkeit und Flexibilität zu geben, diese finanziellen Zusatzausgaben strecken zu können. Wichtig: Die Prämie darf nur neben dem geschuldeten Lohn gezahlt werden. Wenn dem Arbeitnehmer also zum Beispiel (tarif-)vertraglich ein Weihnachtsgeld zusteht, darf der Arbeitgeber nicht stattdessen eine Inflationsprämie zahlen. Außerdem dürfen auch keine Teile des Lohns als Prämie umgewandelt werden, um so Sozialversicherungsausgaben und Steuern zu umgehen. Wichtig auch: Wieder ist die Gewährung der Prämie allein Sache des Arbeitgebers. Die er aus der eigenen Tasche leistet, ohne dass ihm davon etwas erstattet wird. Auch das sollte Mitarbeitern im Zweifel deutlich gemacht werden, um der aus den Zeiten des Corona-Bonus bekannten, irrigen Annahme vorzubeugen, dass den Firmen dafür irgendein Ausgleich gewährt wird. Mehrere Teilbeträge möglich Die Nettoprämie ist zum Inflationsausgleich gedacht und kann bis 31. Dezember 2024 steuerfrei auch in mehreren Teilbeträgen gezahlt werden. Es soll genügen, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Leistung in beliebiger Form deutlich macht, dass diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht. Das kann zum Beispiel geschehen durch einen entsprechenden Hinweis auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnabrechnung, aus dem hervorgeht, dass die zusätzliche, steuerfreie Zahlung im Zusammenhang mit den Preissteigerungen steht. Ob bzw. wann in Anbetracht der wirtschaftlichen Gesamtsituation eine Sonderzahlung möglich ist und wenn ja, in welcher Höhe, entscheidet am Ende allein der Arbeitgeber. Zurück
Neue Handwerkerdatenbank für den Erhalt des Kulturerbes
Diese neue Datenbank schafft Transparenz für Eigentümerinnen und Eigentümer, und sie verschafft den Betrieben Sichtbarkeit. Neue Handwerkerdatenbank für den Erhalt des Kulturerbes Wer Kulturgut restaurieren lassen will, steht vor der Herausforderung, einen darauf spezialisierten Handwerksbetrieb zu finden. Eine vollkommen neu aufgebaute Datenbank des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) mit einem kompletten Relaunch und Redesign steht hierfür nun zur Verfügung. Diese qualitätsgesicherte Datenbank ist jederzeit und auf allen Endgeräten gleichermaßen komfortabel abrufbar. Rund 450 handwerkliche Restaurierungsunternehmen präsentieren sich auf der neuen Website restaurierung-handwerk.de mit ihrem vielfältigen Leistungs- und Erfahrungsspektrum. Gelistet sind ausschließlich Betriebe, die bei den Handwerkskammern eingetragen sind und ihre Aufträge mit qualifizierten Beschäftigten durchführen. Darüber hinaus erfüllen alle gelisteten Betriebe zusätzliche Voraussetzungen in Form von Qualifizierungen, Zertifizierungen oder Auszeichnungen beziehungsweise Referenzobjekten, die sie als Experten für die Arbeit in Restaurierung und Denkmalpflege ausweisen. Die Datenbank bietet eine komfortable Recherche nach Handwerk, Region, spezifischen Leistungen, Fachgebieten und Zulassungskriterien der Restaurierungsbetriebe. Die Nutzung der Datenbank ist kostenlos. Qualifizierte Handwerksunternehmen können sich für eine geringe Jahresgebühr von 50,- Euro brutto pro Jahr auf der Website registrieren lassen – wenn sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Damit ist die Datenbank restaurierung-handwerk.de ein unverzichtbares Rechercheportal für alle handwerklichen Leistungen zum Erhalt von Kulturerbe. Für Handwerkerinnen und Handwerker ist die Denkmalpflege inhaltlich spannend, weil hier anspruchsvolle historische und neue Handwerkstechniken gefragt sind. Auf Seiten von Eigentümerinnen und Eigentümern, Architekten und Denkmalbehörden besteht allerdings der Wunsch, nur besonders qualifizierte und geeignete Handwerksunternehmen mit Maßnahmen an ihren historischen Bauten und Objekten zu betrauen. Um diesem Wunsch entgegenzukommen und Transparenz über diese Betriebe zu schaffen, hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) seine Datenbank neu aufgebaut und mit Zugangskriterien für die Aufnahme unterlegt. Nur besonders qualifizierte oder ausgezeichnete Handwerksbetriebe können sich hier eintragen. Ein Beirat, bestehend aus wichtigen Akteuren zum Erhalt von Kulturerbe, überprüft laufend die Voraussetzungen zur Aufnahme und passt sie an. Der Kriterienkatalog umfasst inzwischen 13 dieser besonderen Zulassungskriterien. Zudem sind die Handwerkskammern als handwerksrechtlich zuständige Stellen vor Ort in die Prüfung eingebunden. Aktuelle Zulassungskriterien und Gebühren Zurück
Dunkler und kälter, um Energie zu sparen – Neue Vorgaben ab 1. September
Dunkler und kälter, um Energie zu sparen Jeder Unternehmer tut gerade alles, um seine Energiekosten zu reduzieren. Mit der „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen“ (EnSikuMaV) hat die Bundesregierung seit 1. September eine rechtliche Grundlage geschaffen, um Energiesparen vorzuschreiben. Sie gilt vorerst bis zum 28. Februar 2023 und betrifft auch das Handwerk. Die wichtigsten Regelungen haben wir hier für Sie zusammengefasst: Außenbeleuchtung Die Beleuchtung von Gebäuden von außen ist untersagt. Eine Ausnahme gilt für Sicherheits- und Notbeleuchtung. Ebenfalls ausgenommen sind kurzzeitige Beleuchtungen bei Kulturveranstaltungen und Volksfesten sowie allgemein alle Fälle, in denen die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist und nicht kurzfristig durch andere Maßnahmen ersetzt werden kann. Somit dürfen dekorative Fassadenbeleuchtungen nicht mehr betrieben werden. Eine Beleuchtung von Treppenstufen oder die Beleuchtung eines Hauseinganges mittels Bewegungsmelder bleibt dagegen gestattet. Reklameleuchten Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen ist von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages untersagt. Das betrifft insbesondere beleuchtete Firmenlogos und -schriftzüge. Nach der Bauordnung vieler Länder sind Werbeanlagen „ortsfeste Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettelanschläge und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen.“ Es gelten dieselben Ausnahmen wie bei der Fassadenbeleuchtung; sie bleibt zulässig, wenn sie aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist. Wann Letzteres der Fall ist, ist nicht ganz eindeutig. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass der beleuchtete Schriftzug über dem Eingang nicht erforderlich ist, wenn der Fußweg durch Straßenlaternen beleuchtet ist. Die Notwendigkeit der Beleuchtung wird auch nicht damit begründet werden können, dass ohne Leuchtreklame nicht erkennbar sei, dass das Geschäft geöffnet hat. Innenraumbeleuchtung Die Innenraumbeleuchtung, insbesondere die Beleuchtungen von Theken und Schaufenstern ist nicht von der Beschränkung erfasst. Sie darf daher während der gesamten Öffnungszeiten, aber auch davor und danach betrieben werden. Anderslautende Behauptungen, die vor allem in verschiedenen Sozialen Medien kursieren, sind falsch. Ladentüren Ladentüren müssen geschlossen bleiben. Das dauerhafte offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen, bei deren Öffnung ein Verlust von Heizwärme auftritt, ist untersagt, sofern es nicht für die Funktion des Ein- oder Ausganges als Fluchtweg erforderlich ist. Zurück
Aktualisierte Richtlinien für Mini- und Midi-Jobs
Aktualisierte Richtlinien für Mini- und Midi-Jobs Mit dem 1. Oktober treten neue Regelungen rund um Mini-Jobs und den Übergangsbereich (Midi-Jobs) in Kraft. Der ZDH hat dazu in seinem Flyer die wichtigsten Informationen, u.a. zu Abgaben und Beiträgen bei geringfügiger Beschäftigung im Handwerk, zusammengestellt. Regelungen, Abgaben und Beiträge Ratgeber Handwerk Flyer als PDF Zurück
Handwerk fordert Bildungswende
Handwerk fordert Bildungswende Das Handwerk hat beim ZDH-Forum „Zukunft braucht Können – Fachkräfte für das Handwerk“ auf der IHM an die Politik appelliert, eine Bildungswende zu vollziehen hin zu einer stärkeren Wertschätzung und ideellen wie finanziellen Förderung der Berufsbildung. Das Handwerk hat beim ZDH-Forum „Zukunft braucht Können – Fachkräfte für das Handwerk“ am Donnerstag auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit einem Bildungsaufruf an die Politik appelliert, eine Bildungswende zu vollziehen hin zu einer deutlich stärkeren Wertschätzung und ideellen wie finanziellen Förderung der beruflichen Bildung. In den Reden und Diskussionsbeiträgen während des ZDH-Forums wurde einhellig darauf hingewiesen, dass die ökologische und digitale Transformation nur gelingen kann, wenn ausreichend qualifizierte Fachkräfte im Handwerk sie vor Ort umsetzen. „Der Mangel an Nachwuchs bei qualifizierten Fachkräften im Handwerk stellt nicht allein für das Handwerk, sondern für unsere Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt ein Problem dar, da er generell unsere Zukunftsfähigkeit bedroht“, betonte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), zu Beginn des ZDH-Forums. Klimaschutz und Energiewende könne es nur mit dem Handwerk und nur mit seinen qualifizierten Fachkräften geben. „Millionen Handwerkerinnen und Handwerker sind bereits jetzt täglich aktive Klimaschützer, wenn sie Solardächer installieren, Ladesäulen für die E-Mobilität und Windparks bauen, wenn sie Heizungen austauschen und Häuser energieeffizient sanieren und bauen“, so Wollseifer. Aber auch für die Aufrechterhaltung der täglichen Daseinsversorgung – etwa mit Lebensmitteln oder mit Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen einer alternden Gesellschaft – seien qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker unverzichtbar. Ausgelöst durch die vielen gleichzeitigen und ineinandergreifenden Krisen aktuell steige der Druck zur Transformation und damit auch der Druck auf das Handwerk als dem Transformations-Umsetzer. Gleichzeitig fehlen im Gesamthandwerk schon jetzt schätzungsweise rund 250.000 Fachkräfte – Tendenz steigend. Diese Fachkräftelücke werde sich voraussichtlich in den kommenden Jahren zum einen wegen der demografischen Entwicklung und zum anderen des weiter anhaltenden Dranges zum Studium weiter vergrößern. Jedes Jahr bleiben allein im Handwerk um die 20.000 von Betrieben angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt, weil Bewerberinnen und Bewerber fehlen. Zugleich wechseln viele qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Rund 125.000 Handwerksbetriebe stehen in den nächsten fünf Jahren zur Nachfolge an. „Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass wir all die zusätzlichen Vorhaben besonders im Klima- und Umweltschutz mit dem jetzigen Stamm an Beschäftigten nicht hinbekommen werden. Wir brauchen also nicht nur eine Klimawende. Wir brauchen nicht nur eine Energiewende. Wir brauchen nicht nur eine Mobilitätswende. Für all das brauchen wir vor allem eine Bildungswende“, bringt es Handwerkspräsident Wollseifer auf den Punkt. Mit einem Aufruf zur Bildungswende appellierte die Handwerksorganisation an die Politik, die Fachkräftesicherung aktiv zu unterstützen und nennt als vorrangige vier Handlungsfelder: eine gleichwertige Behandlung beruflicher und akademischer Bildung, eine gesetzliche Festschreibung der Gleichwertigkeit, eine Entlastung von Ausbildung und Ausbildungsbetrieben und eine bundesweit flächendeckende Berufsorientierung zu den Möglichkeiten beruflicher Bildung. In zwei Panels während des ZDH-Forums diskutierten Vertreter aus Politik, Gesellschaft und dem Handwerk über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung. Einig waren sich die Teilnehmer von Panel 1, dass berufliche Bildung das Können im Handwerk sichert. Was die Bildungspolitik leisten muss, um genügend beruflich ausgebildete Fachkräfte für das Handwerk zu sichern, darüber tauschten sich der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael Piazolo, der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, der Handwerksunternehmer und Preisträger des „Heribert-Späth-Preises“ für besonders gelungene Ausbildungsleistungen Johannes Demmelhuber sowie der ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer aus. Was Arbeitsmarktpolitik und Zuwanderung zur Fachkräftesicherung beitragen können, war Diskussionsgegenstand im Panel 2 mit der designierten Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles, dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Prof. Dr. Michael Hüther, der Mitinhaberin eines Malerbetriebs und Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern der UnternehmerFrauen im Handwerk Claudia Beil sowie ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Zur Bildergalerie des IHM-Forums Über die IHM Die Internationale Handwerksmesse (IHM) mit Garten München und „Handwerk & Design“ findet 2022 erstmals und einmalig im Sommer auf dem Messegelände München statt. Besucherinnen und Besucher können sich vom 6. bis 10. Juli 2022 (Mittwoch bis Sonntag) zu allen Themen rund ums Handwerk inspirieren und beraten lassen. Mit diesmal rund 650 Ausstellerinnen und Ausstellern aus 60 Gewerken ist sie die internationale Leitmesse des Handwerks. Zum ZDH-Messeüberblick Quelle: https://www.zdh.de/presse/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/handwerk-fordert-bildungswende/https://www.zdh.de/presse/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/handwerk-fordert-bildungswende/ Zurück

Das Portal „Handwerk macht Schule“ des Deutschen Handwerkskammertags (DHKT) ist ab sofort verfügbar
Wir bringen die Themen des Handwerks in die Schule und den Unterricht Das Portal „Handwerk macht Schule“ des Deutschen Handwerkskammertags (DHKT) ist ab sofort verfügbar und stellt, in Kooperation mit dem Eduversum-Verlag, kostenlose Lehrinhalte für Lehrer an allgemeinbildenden Schulen bereit. Parallel dazu sind alle Inhalte des Portals auf der reichweitenstarken Plattform „Lehrer online“ integriert. Das Portal flankiert die erfolgreiche Kampagne des Handwerks im Schulunterricht: Dabei werden Alltagsbezug und Lebensnähe großgeschrieben. Hauptziel ist, Vielfalt und Zukunftspotenziale des Handwerks aufzuzeigen. Dabei geht es jedoch um weit mehr als um Mörtel, Malerpinsel, Mehl oder Maulschlüssel. Im Fokus stehen vor allem Themen wie Zukunft, Innovation und Nachhaltigkeit. https://www.handwerk-macht-schule.de/ Zurück
Notfallplan Gasversorgung
Notfallplan Gasversorgung Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, hat das Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Alarmstufe des Notfallplans Gas in Deutschland ausgerufen. Die Alarmstufe folgt auf die am 30. März 2022 ausgerufene Frühwarnstufe. In der Alarmstufe funktioniert der Markt weiterhin und kann die Versorgung sicherstellen, jedoch ist mit weiter steigenden Preisen zu rechnen. Mit der Ausrufung der Alarmstufe ist aber kein Automatismus verbunden, der den Energieversorgungsunternehmen erlauben würde, die Preise in ihren Verträgen sofort einseitig zu erhöhen. Hierzu müsste zusätzlich die Bundesnetzagentur (BNetzA) öffentlich die „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ feststellen, was im § 24 des Energiesicherungsgesetz (EnSiG) geregelt ist. Gemeinsam mit den Fachverbänden beobachtet der ZDH das Geschehen sehr genau und steht in ständigem Kontakt zu BMWK und BNetzA. Neben der Sicherstellung einer größtmöglichen Versorgungssicherheit der Handwerksbetriebe, die absehbar auf hinreichende Gaslieferungen insbesondere für ihre Arbeitsprozesse angewiesen sind, haben hat der ZDH auch die immer stärker steigenden Energiepreise im Blick, für welche gerade die besonders betroffenen Betriebe noch nicht oder nicht adäquat in den staatlichen Hilfsprogrammen berücksichtigt werden. Auch hierzu steht er in intensivem Dialog mit dem BMWK. Der Notfallplan Gasversorgung Der Notfallplan beruht auf den im Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), im Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung (EnSiG) und in der Verordnung zur Sicherung der Gasversorgung in einer Versorgungskrise (GasSV) niedergelegten Regelungen. Diese deutschen Vorschriften wiederum haben ihre EU-rechtliche Grundlage in der Verordnung (EU) 2017/1938 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung (SoS-VO). Entsprechend der SoS-VO wurden drei Krisenstufen mit jeweils spezifischen zu ergreifenden Maßnahmen definiert: Frühwarnstufe Alarmstufe Notfallstufe. Zu diesen Stufen folgende Hinweise: Frühwarnstufe:Sie wird vom Bundeswirtschaftsminister ausgerufen, wenn konkrete, ernstzunehmende und belastbare Hinweise dafür vorliegen, dass es zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie zur Auslösung der Alarm- bzw. der Notfallstufe kommen kann. Die Bedingungen sind angesichts drohender Engpässe in der Energieversorgung aus Russland gegeben. Die Ausrufung der Frühwarnstufe bedeutet noch keine akuten Engpässe in der Versorgung der Gesamtwirtschaft und damit auch des Handwerks mit Gas für Wärme- oder Produktionsprozesse. Sie soll derartige drohende Konsequenzen auf ein möglichst geringes Ausmaß begrenzen. Sowohl im Bundeswirtschaftsministerium als auch in der Bundesnetzagentur wurden Krisenstäbe eingerichtet (in der Bundesnetzagentur auch einer zur Stromversorgung). Ihre Aufgabe besteht darin, kontinuierlich ein perspektivisches Gesamtbild über die Gas- Versorgungssicherheit, drohende Engpässe und marktbasierte Möglichkeiten ihrer Entschärfung zu identifizieren. Eine IT-Sicherheitsplattform Gas soll zur Sammlung und Aufbereitung möglichst umfänglicher Gaserzeugungs- und -versorgungsdaten einschließlich der Verflechtungen entlang der Wertschöpfungsprozesse aufgebaut werden. Bis Sommer dieses Jahres soll diese Plattform erstellt und einschließlich einer Simulationsübung getestet worden sein. Alarmstufe:Die Alarmstufe wird entsprechend SoS-VO ausgerufen, wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt, der Markt aber noch in der Lage ist, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen. Der zentrale Aspekt und Leitgedanke dieser Alarmstufe ist, dass marktbasierte Maßnahmen weiterhin – dabei allerdings mit ggf. steigenden Preisen – einen Ausgleich von Nachfrage und Angebot auf dem Gasmarkt gewährleisten können. Zu diesen marktbasierten Maßnahmen gehören insbesondere: Nutzung interner Regelenergie, Optimierung von Lastflüssen, Anforderung externer Regelenergie, Abruf von externer lokaler und/oder netzpunktscharfer Regelenergie. Die Gasversorgungsunternehmen entscheiden in eigener Verantwortung, welche Maßnahme oder welches Maßnahmenbündel erforderlich und geeignet ist, um das Funktionieren des Marktes und die Versorgung der geschützten Kunden so lange wie möglich zu gewährleisten. Zu den geschützten Kunden zählen insbesondere Privathaushalte, das Gesundheitssystem sowie kleine Gewerbebetriebe. Zu letzteren zählen laut Energiewirtschaftsgesetz weitere Letztverbraucher (neben den Haushaltskunden) im Erdgasverteilernetz, bei denen standardisierte Lastprofile anzuwenden sind (§53a EnWG). Notfallstufe:Sie wird ausgerufen, wenn eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere beträchtliche Verschlechterung der Versorgungslage vorliegt und wenn zuvor alle einschlägigen marktbasierten Maßnahmen umgesetzt wurden, aber die Gasversorgung nicht ausreicht, um die noch verbleibende Gasnachfrage zu decken. Ein solcher Notfall steht ggf. für den kommenden Herbst und/oder Winter an. In der Notfallstufe kommen ergänzend nicht marktbasierte Maßnahmen zum Einsatz. Konkret übernimmt dann die Bundesnetzagentur die Zuweisung von Gasmengen, wobei es auch hier weiterhin vorrangig um die Sicherung der Gasversorgung der geschützten Kunden geht. Für diese Notfallstufe wird keine Prioritätenliste erstellt. Entscheidungen zur Gaszuteilung für Unternehmen und Betriebe sollen vielmehr in Ansehung der jeweiligen Rahmenbedingungen getroffen werden, dies unter besonderer Berücksichtigung der wechselseitigen wirtschaftlichen Verflechtung unter Einbeziehung von Zweit- und Drittrundeneffekten und ggf. drohenden Kaskadeneffekten. Die IT-Sicherheitsplattform Gas soll hierfür die datengestützte Grundlage bieten. Die Gasversorgung soll dabei nicht an die Größe eines Unternehmens geknüpft werden. Allerdings ist eine gewisse branchenspezifische Priorisierung, wie insbesondere für den Lebensmittel- und den Pharmabereich, geplant. Weitere Informationen finden Sie in der vom BMWK veröffentlichten FAQ Liste – Notfallplan Gas. PDF Notfallplan Gas Zurück
Europäische Energie- und Klimawende braucht das Handwerk
Europäische Energie- und Klimawende braucht das Handwerk Der Industrie- und Handelsausschuss hat am Mittwoch seine Positionen zu Erneuerbaren Energien sowie zur Energieeffizienz als Teil des „Fit für 55“-Pakets verabschiedet. Dazu erklärt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH): „Die Annahme seiner Positionen zu Erneuerbaren Energien im Industrieausschuss ist ein wichtiger und ambitionierter Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Fachkräfte des Handwerks sind dafür ein unverzichtbares Standbein der beschleunigten Wende. Ausdrücklich positiv bewerten wir es, dass die Berichterstatter den Aspekt der ganzheitlichen Qualifikation von dringend benötigten Fachkräften berücksichtigen und nicht nur auf schnelle, punktuell schulende Zertifizierungsmodelle setzen. Gerade bei der Umsetzung von nachhaltigen Energie- und Effizienzmaßnahmen ist etwa das Verständnis über ein Gebäude als Ganzes von unschätzbarem Wert und sichert hochwertige und langlebige Lösungen. Angesichts der hohen Energie-, Material- und Beschaffungspreise, anziehender Zinsen und steigender Inflation ist es für die europäische Energie- und Klimawende von entscheidender Bedeutung, solche Instrumente einzusetzen, die helfen, die Klimaziele kosteneffizient zu erreichen, und zudem dafür Sorge zu tragen, Handwerksbetriebe nicht unnötig und zusätzlich zu belasten. Klimaschutz und Energieunabhängigkeit dürfen sich nicht als Bremsklötze für Handwerksbetriebe erweisen. Umso wichtiger ist es, maßgeschneiderte KMU-Instrumente anzuwenden, um die Energieeffizienz in den Betrieben zu verbessern, etwa durch Instrumente wie das im Handwerk bereits erfolgreich eingesetzte „E-Tool“ zur Sammlung von betrieblichen Energiedaten und der darauf aufbauenden zielgenauen Umsetzung von Effizienzmaßnahmen. Wir erwarten daher, dass die künftige Energieeffizienzrichtlinie dahingehend Türen weiter öffnet und Mitgliedstaaten das konsequent aufnehmen. Nur so wird es gelingen, die unverzichtbare Expertise und Leistungsfähigkeit des Handwerks für die Umsetzung des „Fit für 55“-Pakets auszuschöpfen.“ Hintergrundinformationen: Mit dem Europäischen Klimagesetz hat die EU ein neues verbindliches Minderungsziel für Treibhausgase bis zum Jahr 2030 festgelegt: Um mindestens 55% sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 sinken. Zur Umsetzung dieses Ziels arbeiten die EU-Gesetzgeber Rat und Europäisches Parlament (EP) derzeit an ihrer Positionierung im Rahmen des „Fit für 55“-Pakets. Quelle: https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-europapolitik/eu-aktuell/europaeische-energie-und-klimawende-braucht-das-handwerk/ Zurück
Regeln für den Arbeitsvertrag: Strengere Vorgaben durch das Nachweisgesetz ab dem 1. August 2022
Regeln für den Arbeitsvertrag: Strengere Vorgaben durch das Nachweisgesetz ab dem 1. August 2022 Das Nachweisgesetz verpflichtet Betriebe, ihre Mitarbeiter über die getroffenen Inhalte des Arbeitsvertrags schriftlich zu informieren. Eine Neuauflage auf Grundlage der EU-Arbeitsbedingungenrichtlinie 2019/1152 tritt am 1. August 2022 in Kraft. Für Neuverträge müssen die Konditionen nun umfangreicher gefasst werden, bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder. Auch für Altverträge empfiehlt sich die Nachbesserung. Aber auch Altverträge, die Arbeitgeber wegen Vertragsänderungen anfassen, müssen sie entsprechend angleichen. Wichtig zu wissen: Es gibt keine Übergangsfrist, Betriebe sind aufgefordert, die neuen Regelungen ab 1. August 2022 anzuwenden. Ziel ist es, die Beschäftigung für Arbeitnehmer transparenter und vorhersehbarer zu gestalten. Mit der Neuauflage des Gesetzes sind die Betriebe aufgefordert, Neuverträge nach den neuen Vorgaben zu verfassen. Bislang genügte es, wenn der Mitarbeiter spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses einen Arbeitsvertrag schriftlich und unterzeichnet erhielt, der die Anschrift der Vertragsparteien, den Beginn der Beschäftigung und bei befristeten Arbeitsverhältnissen die Dauer, Arbeitsort, Arbeitszeiten und die Zahl der Urlaubstage benannte. Außerdem war eine kurze Tätigkeitsbeschreibung vorzunehmen und eine Kündigungsfrist anzugeben. Mit den beschlossenen Änderungen des Nachweisgesetzes werden die bereits geltenden Pflichten erweitert und weitere Anforderungen an Arbeitsbedingungen gestellt. Sie gelten für alle Arbeitnehmer. Die bisher enthaltene Ausnahme für Aushilfen, die höchstens einen Monat beschäftigt sind, wird gestrichen. Ziel des Nachweisgesetzes ist es, Arbeitnehmer über den Inhalt ihres Arbeitsvertrags in schriftlicher Form hinreichend zu informieren und für alle Beteiligten Transparenz zu schaffen. Neben den bisher schon bestehenden Nachweispflichten sieht das Gesetz nun insbesondere die folgenden erweiterten Angaben vor: Bei der Zusammensetzung des Arbeitsentgelts auch die Vergütung von Überstunden sowie die Art der Auszahlung. Vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen. Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen. Dauer einer vereinbarten Probezeit. Hinweis, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort frei wählen kann. Bei Arbeit auf Abruf, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat, die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, der Zeitrahmen, der für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt ist, und die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat. Ein etwaiger Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung. Informationen über den Versorgungsträger, wenn der Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung über einen solchen zusagt. Das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für eine Kündigung und zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage. Auswirkungen für neue und alte Arbeitsverträge Die neuen Nachweispflichten gelten unmittelbar gegenüber allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihr Beschäftigungsverhältnis am 1. August 2022 beginnen. Bereits am ersten Arbeitstag müssen Betriebe neuen Mitarbeitenden einen Teil der Informationen (Name und Anschrift der Vertragsparteien, Arbeitsentgelt und Überstunden, Arbeitszeit) schriftlich aushändigen. Weitere Informationen (insbes. Beginn des Arbeitsverhältnisses, ggf. Befristung, Arbeitsort, Tätigkeitsbeschreibung und Überstunden) müssen innerhalb von sieben Tagen nachgereicht werden. Für die übrigen Informationen hat der Arbeitgeber einen Monat Zeit. Letztlich empfiehlt sich für die Praxis, dass neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits vor Arbeitsbeginn die neuen Verträge inklusiver aller erforderlichen Informationen unterzeichnen sollten. Verträge von Mitarbeitenden, die bereits vor dem 1. August 2022 in einem Unternehmen beschäftigt waren, bleiben hingegen unverändert. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben allerdings das Recht, ihren Arbeitgebenden dazu aufzufordern, ihnen die neuen Informationen mitzuteilen. Dieser muss dann grundsätzlich innerhalb von sieben Tagen reagieren und bereits die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich aushändigen. Weitere Informationen etwa über das Kündigungsverfahren, den Urlaub, die betriebliche Altersversorgung oder Fortbildungen müssen spätestens innerhalb eines Monats bereitgestellt werden. Das kann jeweils auch durch ein Informationsblatt geschehen, das aber ebenfalls in Schriftform ausgehändigt werden muss. Sollten sich außerdem wesentliche Arbeitsbedingungen ändern, muss der Arbeitgeber die Belegschaft initiativ bereits am Tag der Änderung schriftlich davon unterrichten. 2.000 Euro Bußgeld möglich – pro Verstoß Bei einem Verstoß gegen das Nachweisgesetz kann zukünftig ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro pro Verstoß fällig werden. Wer also systematisch etwa gegen das Schriftformerfordernis verstößt, die Auskünfte nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aushändigt, muss – gerade bei einer hohen Anzahl von Mitarbeitenden – tief in die Tasche greifen. Dass das Nachweisgesetz nicht eingehalten wird, kann z.B. bei Sozialversicherungs- oder Rentenprüfungen sowie bei Kontrollen des Zoll zum Mindestlohn auffallen. Zurück
Klimatransformation im Betrieb
Klimatransformation im Betrieb Der innerbetriebliche Energieverbrauch ist vor allem für energieintensive Gewerke von Bedeutung. Dabei bietet das Handwerk Unterstützungsangebote wie die „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ oder „Initiative Eneergieeffizienznetzwerke“. Der innerbetriebliche Energieverbrauch spielt für energieintensive Gewerke, wie z.B. Bäcker, Fleischer oder Tischler, eine zentrale Rolle. Dies liegt daran, dass die Energiekosten, im Fall der Bäcker bis zu 9,9 Prozent an den Gesamtkosten ausmachen. Bei Fleischern sind es beispielsweise 9,4 Prozent und bei Tischlern 9 Prozent (Quelle: DHI). Es zeigt sich, dass sich rund 15 Prozent der Handwerksbetriebe zum innerbetrieblichen Energieverbrauch beraten lassen. Die Nachfrage nach einer Energieeffizienz-Beratung hängt dabei nicht nur von der Energieintensität des jeweiligen Betriebes, sondern auch von der Anzahl der Mitarbeiter ab. So zeigt sich, dass von den Unternehmen mit 20 Beschäftigten rund 20 Prozent der Betriebe eine Energieeffizienz-Beratung beauftragen, während bei Betrieben mit mehr als 100 Mitarbeitern bereits 40 Prozent der Betriebe eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen. Diese Sensibilität größerer Handwerksbetriebe für das betriebliche Energieeffizienz-Potenzial findet sich aufgrund der geringen Personalstärke in kleineren Handwerksbetrieben seltener. Doch auch bei diesen kleineren Betrieben, die rund 80 Prozent der Handwerksbetriebe in Deutschland ergeben und im Schnitt fünf Mitarbeiter haben, liegt teilweise eine hohe Energieintensität vor. Dies gilt es zu ändern, zumal es mit der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz (MIE) ein Angebot gibt, dass über Strukturen und Instrumente verfügt, die maßgeschneidert die innerbetriebliche Energieeffizienz und den Weg zu mehr Klimaschutz im Unternehmen adressieren. Da die Instrumente mit über 700 Handwerksbetrieben entwickelt und erprobt wurden, passen die Instrumente zu den handwerklichen Betriebserfordernissen und werden von den Betrieben akzeptiert. Die Instrumente sind hochgradig anschlussfähig zu künftigen betrieblichen Erfordernissen der Klimaschutztransformation. Strukturen Die bisherige Struktur besteht im Kern aus einem leistungsfähigen bundesweiten Netzwerk aus sieben Umweltzentren der Handwerkskammern und deren 45 Transferpartnern bei Kammern, Innungen und Verbänden. Koordiniert durch den ZDH, die Umweltzentren des Handwerks und das MIE-Netzwerkwerk der Transferpartner, stehen den Betrieben bundesweit Beraterinnen und Berater zur Unterstützung zur Verfügung. Instrumente Die zum Zweck der Steigerung der innerbetrieblichen Energieeffizienz und der damit einhergehenden CO2-Reduktion entwickelten und erprobten Instrumente – wie beispielsweise der CO2-Mehrkosten Rechner – sind hochgradig anschlussfähig zu den mit der Klimatransformation verbundenen Herausforderungen: Sei es die datengestützte Identifikation geeigneter Klimaschutzmaßnahmen, die Erfüllung rechtlicher Anforderungen oder das Erbringen von Klimaschutznachweisen. Energiewechsel-Kampagne des BMWK BMWK Um die Unterstützung zu erhöhen und Schwung in die Energiewende zu bekommen, hat das BMWK die breit angelegte Kampagne„80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“ gestartet. www.energiewechsel.de Saar-Lor-Lux Umweltz. Eines dieser erprobten und besonders anschlussfähigen Instrumente ist das cloudbasierte digitale E-Tool, das auf der SpaEfV basiert. Über eine nutzergeführte Datenerfassung werden im E-Tool individuelle Auswertungen der Jahresverbräuche und die Identifikation anschließender maßgeschneiderter Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen ermöglicht. Damit kann das E-Tool im Zuge eines digital unterstützten, kontinuierlichen, betrieblichen Verbesserungsprozesses genutzt werden. Mit dem E-Tool erhalten insbesondere solche Betriebe eine Unterstützung, die aufgrund geringer Betriebsgröße ansonsten kein adäquates Instrument zur Verfügung haben. Zudem sind bereits jetzt im E-Tool ein PV-Rechner integriert, die Erfassung der Emissionen des Fuhrparks, eine grafische Darstellung des betrieblichen Transformationsprozesses, die Erstellung eines betrieblichen CO2-Fussabdrucks sowie auch auf kWh und CO2-Emissionen basierende Benchmarks und Verweise auf Förderprogramme des Bundes. Effizient zur Effizienz und zum Klimaschutz Ziel von Energieeffizienz-Netzwerken ist es, dass teilnehmende Unternehmen kostengünstig und gemeinschaftlich ihre Energieeffizienz und damit die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Daher haben der ZDH, die Bundesregierung und weitere Verbände der Wirtschaft bereits 2014 eine Vereinbarung über die Einführung von Energieeffizienz-Netzwerken unterzeichnet und damit die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke gestartet. Die Initiative wurde aufgrund ihres Erfolgesim Jahr 2021 verlängert und wird bis Ende 2025 fortgeführt. Da die Mitarbeit in Energieeffizienz-Netzwerken bei allen Vorteilen personellen und organisatorischen Aufwand mit sich bringt, übersteigen die Kosten der Netzwerkteilnahme, gerade bei Unternehmen mit weniger als 80.000 Euro Jahresenergiekosten, häufig den Nutzen. Gerade kleinere Unternehmen mit durchschnittlich fünf Mitarbeitern sind der Art strukturiert, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Energieeffizienz-Netzwerke oft suboptimal ist. Dennoch hat das Handwerk in energieintensiven Gewerken Effizienzpotenziale identifiziert, die in für kleine Betriebe passend ausgestalteten Energieeffizienz-Netzwerken effizient gesteigert werden können. Daher hat sich der ZDH für passend ausgestaltete Energieeffizienz-Netzwerk-Formen sowie für eine Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses solcher Energieeffizienz-Netzwerke eingesetzt. Dabei verknüpft das Handwerk sein Engagement im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz mit seinen Aktivitäten im Kontext der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke. Im Ergebnis können die Einrichtungen der Handwerksorganisation, wie bspw. die Kammern, Kreishandwerkerschaften, Innungen etc. als Träger eines Netzwerkes fungieren. Auch dürfen die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter der Kammern und Verbände als Netzwerkmoderatoren auftreten. Zudem können die im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz entwickelten Energieeffizienz-Instrumente, wie z.B. das E-Tool, seitens der Berater der Kammern und Verbände zur Netzwerkarbeit eingesetzt werden. Das erste Energieeffizienz-Netzwerk im Handwerk wurde von den Essener Unternehmerfrauen des Handwerks gegründet und fachlich durch das Umweltzentrum der Handwerkskammer Düsseldorf unterstützt. So wurde das engagierte Netzwerkteam bei der Jahresveranstaltung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke ausgezeichnet. Netzwerk für Energieeffizienz und Klimaschutz Da sich auch die Handwerksorganisation selbst dem Klimaschutz verpflichtet fühlt, haben am 16. Juni 2021 elf Handwerkskammern das erste Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk seiner Art gegründet. Das Netzwerk hat zum Ziel, die Chancen von Energieeffizienz und Klimaschutz in den beteiligten Handwerkskammern zu stärken. Damit tragen die Kammern als Multiplikatoren des Effizienz- und Klimaschutzschutzgedankens in den Regionen zum Erfolg der Netzwerkinitiative bei. Keimzelle dieses Kammernetzwerkes sind die Umweltzentren des Handwerks. Klimaschutz-Maßnahmen können beispielsweise die energieeffiziente Beheizung der Bildungszentren, die Optimierung der Beleuchtung von Veranstaltungsräumen, eine energieeffiziente Optimierung der IT oder aber auch die Installation einer smarten Gebäudetechnik sein. Die beteiligten Handwerkskammern nutzen das im Rahmen der „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ entwickelte E-Tool in der Netzwerkarbeit, um den Energieverbrauch zu analysieren, die Netzwerkarbeit zu administrieren und gemeinsam das Energieeinsparziel zu erreichen. Durch das gemeinsame Engagement der Handwerkskammern in diesem neuen Netzwerk werden die beteiligten Kammern ihre Rolle als Vorbilder und wichtige Multiplikatoren der Nachhaltigkeit in den Regionen weiter stärken und so dazu inspirieren, dass weitere Netzwerke gegründet werden. in Zusammenarbeit mit dem ZDH DHZ-Energiesparserie Die Artikelserie der Deutschen Handwerkszeitung (DHZ) zeigt ausgewählte Handwerksbetriebe mit sehr konkreten und anschaulichen Vorschlägen zum Energieeinsparen in den täglichen Betriebsabläufen. Handwerksbäcker müssen Energiekosten senken: So klappt´s (Datum: 17. Februar 2022) Energie sparen: So klappt’s beim Friseur (Datum: 22.
Gestiegene Energiepreise: Entlastungspaket und Steuerentlastungsgesetz 2022
Entlastungspaket und Steuerentlastungsgesetz 2022 Aufgrund der hohen Energie- und Kraftstoffpreise hat die Bundesregierung mit dem „ Steuerentlastungsgesetz 2022“ verschiedene Steuervergünstigungen auf den Weg gebracht. Zur Entlastung werden dabei folgende steuerliche Maßnahmen vorgesehen, die rückwirkend zum 1.Januar 2022 in Kraft treten: Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags Die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von bislang 1.000 EUR auf 1.200 EUR erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2022.Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird bereits während des Jahres monatlich beim Lohnsteuerabzug in den Steuerklassen I bis V berücksichtigt. Erhöht sich der Arbeitnehmer-Pauschbetrag im Laufe des Jahres 2022 mit steuerlicher Rückwirkung, ist diese rückwirkend im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksichtigen. Eine Arbeitgeberverpflichtung zur rückwirkenden Berücksichtigung besteht nur dann nicht, wenn ihm dies wirtschaftlich nicht zumutbar ist (z. B. weil der Mitarbeiter mittlerweile aus dem Betrieb ausgeschieden ist). Eine Berücksichtigung erfolgt dann im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung des jeweiligen Arbeitnehmers. Erhöhung des Grundfreibetrags Außerdem steigt der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer rückwirkend zum 1.1.2022 von derzeit 9.984 EUR um 363 EUR auf 10.347 EUR.Praxishinweis: Bei Berechnung der Lohnsteuer wird der Grundfreibetrag ebenfalls berücksichtigt. Kommt es zu einer rückwirkenden Erhöhung, ist die Lohnsteuer gleichfalls rückwirkend zu korrigieren, wenn dies dem Arbeitgeber wirtschaftlich zumutbar ist. Eine Verpflichtung zur Neuberechnung scheidet allerdings aus, wenn z. B. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber keinen Arbeitslohn mehr bezieht oder wenn die Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt oder ausgeschrieben worden ist. In diesen Fällen tritt der Effekt aus der Erhöhung des Grundfreibetrags im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung ein.Praxishinweis: Der zuvor vorgenommene Lohnsteuerabzug ist nach dem Inkrafttreten der Änderungen im Juni 2022 vom Arbeitgeber zu korrigieren, wenn ihm dies wirtschaftlich zumutbar ist (§ 41c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 EStG). Die Finanzverwaltung hat dazu neue Programmabläufe bekannt gemacht, die ab 1. Juni 2022 anzuwenden sind. Die Art und Weise der Neuberechnung ist jedoch nicht zwingend festgelegt. Sie kann durch eine Neuberechnung zurückliegender Lohnzahlungszeiträume, durch eine Differenzberechnung für diese Lohnzahlungszeiträume oder durch eine Erstattung im Rahmen der Berechnung der Lohnsteuer für einen demnächst fälligen sonstigen Bezug erfolgen. Eine Verpflichtung zur Neuberechnung scheidet aus, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin keinen Arbeitslohn mehr bezieht oder wenn die Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt oder ausgeschrieben worden ist (§ 41c Absatz 3 EStG).Ändert der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nicht, können die höheren Freibeträge bei der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend gemacht werden. In Ausnahmefällen können Betroffene beim Betriebsstättenfinanzamt bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung eine Erstattung der Lohnsteuer beantragen (§ 41c Absatz 3 EStG, R 41c.1 Absatz 5 Satz 3 LStR). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den höheren Grundfreibetrag und den höheren Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Berechnung der Lohnsteuer zu berücksichtigen. Erhöhung der Entfernungspauschale für Fernpendler und lohnsteuerliche Folgewirkungen Vor dem Hintergrund der aktuellen Benzinpreisentwicklung erfolgt eine vorgezogene Erhöhung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab dem 21. Kilometer um 3 Cent pro Kilometer von 35 Cent auf 38 Cent.Praxishinweis: Es bleibt abzuwarten, ob auch die Fahrtkostenpauschale bei Reisekosten von gegenwärtig 0,30 EUR/km (PKW) rückwirkend ab 1. Januar 2022 angehoben wird. Folgewirkung auf die Lohnsteuer-Pauschalierung Die geplante Erhöhung der Entfernungspauschale ab dem 21. wirkt sich auch auf das Lohnsteuer-Pauschalierungsvolumen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG aus. Nach § 40 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15 % für die nicht nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Leistungen, die in § 40 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 Buchst. a) bzw. Buchst. b) EStG genannt sind, pauschalieren. Der Höhe nach ist die Pauschalierung auf die Beträge begrenzt, die der Arbeitnehmer ansonsten als Werbungskosten geltend machen könnte. Die gestaffelte Entfernungspauschale wirkt sich somit auf die Pauschalierungshöhe aus. 300 Euro Energiepauschale 2022 Allen aktiv sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen der Steuerklassen 1 bis 5 soll noch im Jahr 2022 einmalig eine Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Die Energiepreispauschale soll unabhängig von den geltenden steuerlichen Regelungen ( Pendlerpauschale bzw. Entfernungspauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) »on top« gewährt werden. Der Anspruch auf die EPP entsteht am 1.9.2022. Die Pauschale soll der Einkommensteuer unterliegen. Zusätzlich fallen ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an.Bei Arbeitnehmern soll die Auszahlung über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers bzw. des Dienstherrn erfolgen. Arbeitgeber haben die EPP dazu in der Regel im September 2022 an ihre Arbeitnehmer auszuzahlen. Die Arbeitgeber sollen die Pauschale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer entnehmen dürfen. Bei vorschüssiger Lohn-/Gehalts-/Bezügezahlung ist eine Auszahlung mit der Abrechnung für den Lohnzahlungszeitraum September 2022 aus steuerrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung vierteljährlich ab, kann die EPP an den Arbeitnehmer davon abweichend im Oktober 2022 ausgezahlt werden (Wahlrecht). Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung jährlich ab, kann er ganz auf die Auszahlung an seine Arbeitnehmer verzichten. Die Arbeitnehmer können in diesem Fall die EPP über die Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 erhalten.Kann die Auszahlung aus organisatorischen oder abrechnungstechnischen Gründen nicht mehr fristgerecht im September 2022 erfolgen, bestehen keine Bedenken, wenn die Auszahlung mit der Lohn-/Gehalts-/Bezügeabrechnung für einen späteren Abrechnungszeitraum des Jahres 2022, spätestens bis zur Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeitnehmer, erfolgt.Übersteigt die insgesamt zu gewährende EPP den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt erstattet, an das die Lohnsteuer abzuführen ist. Technisch wird dies über eine sog. Minus-Lohnsteuer-Anmeldung abgewickelt. Ein gesonderter Antrag des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Der Erstattungsbetrag wird in diesem Fall auf das dem Finanzamt benannte Konto des Arbeitgebers überwiesen.Eine Kostenerstattung für die Auszahlungsabwicklung ist für Unternehmen nicht vorgesehen. Der Kostenaufwand kann sich allerdings nach den allgemeinen Regeln steuermindernd auswirken.Selbständige sollen die Energiepreispauschale über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung erhalten. Die Herabsetzung der Vorauszahlungen erfolgt verwaltungsintern. Wurden bereits für den 10. September 2022 auf der Grundlage des „alten“ Vorauszahlungsbescheides Zahlungen an das Finanzamt geleistet, wird der überzahlte Betrag automatisch auf das Konto zurückerstattet, soweit keine weiteren Steuerrückstände bestehen.Praxishinweis: Eine FAQ-Liste der Finanzverwaltung beantwortet weitere Fragen u.a. zur Anspruchsberechtigung, zur Festsetzung mit der Einkommensteuerveranlagung, zur Auszahlung an Arbeitnehmer durch Arbeitgeber, zum Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren und zur Steuerpflicht. Kinderbonus Zur Abfederung besonderer Härten für Familien wird für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld ein Einmalbonus in Höhe von 100 EUR über die Familienkassen ausgezahlt. Der Bonus wird auf

Beschäftigung von ukrainischen Staatsbürgern
Infoblatt Netzwerkpartner Beschäftigung von ukrainischen Staatsbürgern Erwerbsfähige ukrainische Staatsangehörige suchen neben dem Schutz in Deutschland häufig auch einen Arbeitsplatz. Viele Arbeitgeber möchten Kriegsflüchtlingen helfen und in ihren Betrieben beschäftigen. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ukrainische Flüchtlinge eine Beschäftigung in Deutschland aufnehmen können? Aus der Ukraine Geflüchtete benötigen nach der visumfreien Einreise vorübergehend bis maximal 90 Tage und spätestens bis 24. Mai 2022 keinen Aufenthaltstitel. Wer als Kriegsflüchtling in Deutschland Schutz bekommt und eine Beschäftigung aufnehmen möchte, benötigt allerdings immer noch eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde. Diese werden derzeit auf Grundlage der „Massenzustrom-Richtlinie“ für Kriegsflüchtlinge parallel zur Aufenthaltserlaubnis umgehend erteilt. Eine besondere Qualifikation, deutsche Sprachkenntnisse oder ein konkretes Jobangebot, muss nicht nachgewiesen werden. Betriebe, die ukrainische Staatsangehörige beschäftigen möchten, sollten umgehend einen Termin für eine unbürokratische Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mit integrierter Arbeitserlaubnis vereinbaren. Der Antrag wird bei der Ausländerbehörde am Wohnort/Aufenthaltsort der Mitarbeitenden gestellt. Eine zusätzliche Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist in diesem Fall nicht nötig. Eine Aufenthaltserlaubnis endet grundsätzlich nach 12 Monaten, kann aber auf maximal 3 Jahre verlängert werden. Was müssen Arbeitgeber tun, wenn eine Arbeitserlaubnis besteht und eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen wird? Werden Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigt, unterliegen sie grundsätzlich den deutschen Rechtsvorschriften in allen Zweigen zur Sozialversicherung, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Innerhalb von 6 Wochen muss eine Anmeldung bei einer gesetzlichen Krankenkasse erfolgen. Für ukrainische Staatsangehörige ist das Länderkennzeichen (LDKZ) „UA“ und der Staatsangehörigkeitsschlüssel (SASC) „166“ anzugeben. Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge sind für die neuen Mitarbeitenden abzuführen. Was ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beachten? Mit Aufnahme der versicherungspflichtigen Beschäftigung erlangen die ukrainischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sofort den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz. Aufgrund dieser Versicherung können auch Familienangehörige (Kinder, Ehegatten und Lebenspartner) kostenlos mitversichert werden. Versicherte erhalten mit der Anmeldung eine elektronische Gesundheitskarte für die Inanspruchnahme der Leistungen. Endet das Beschäftigungsverhältnis bereits vor Ablauf von 5 Jahren, muss zu dem Zeitpunkt geprüft werden, ob aufgrund der gezahlten Beiträge zur Rentenversicherung ein Anspruch entstanden oder ob gegebenenfalls eine Erstattung der Beiträge zu beantragen ist. Was müssen Arbeitgeber tun, wenn eine Arbeitserlaubnis besteht und eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen wird? Bei der Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung ist die zuständige Einzugsstelle die Minijob-Zentrale. Der Versicherungsschutz der ukrainischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss in diesem Fall anderweitig sichergestellt sein. Zuständig für die sofortige Realisierung der Leistungsansprüche der Flüchtlinge sind die durch landesrechtliche Regelungen bestimmten Behörden, sofern nicht bereits Krankenkassen per Vereinbarung nach dem Sozialgesetzbuch mit der Leistungserbringung beauftragt sind oder beauftragt werden. An wen können sich Betriebe und ukrainische Mitarbeitende im Falle von Fragen zum Versicherungsschutz wenden? Die IKK classic beantwortet unter der IKK Firmenkunden-Hotline 0800 045 5400 sämtliche Fragen rund um den Versicherungsschutz. Text als pdf Zurück

DU BIST IN DER AUSBILDUNG UND BRAUCHST SUPPORT BEIM LERNEN?
DU BIST IN DER AUSBILDUNG UND BRAUCHST SUPPORT BEIM LERNEN? Geflüchtete Menschen sehen sich in der Berufsausbildung mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Die Fachthemen sind anspruchsvoll, es bestehen noch immer Unsicherheiten beim deutschen Sprachgebrauch, mitunter Förderbedarfe im mathematischen Bereich und damit einhergehend Überforderungen beim Umgang mit komplexen Fragestellungen. In diesen Bereichen bietet das Katholische Bildungswerk Bonn seit 2020 den kostenfreien Förderunterricht UFO an, der sich als ergänzende Fördermaßnahme zu den schulischen Förderangeboten versteht. UFO richtet sich an geflüchtete Menschen ab 18 Jahren, die in der Berufsausbildung sind oder eine berufsvorbereitende Maßnahme besuchen. •UFO baut sprachliche Barrieren ab. •UFO fördert mathematisches Verständnis. •UFO leistet konkrete Hilfe zum eigenständigen Umgang mit komplexen Fragestellungen. •UFO vermittelt Lerntipps & Tricks, die die Scheu vorm Sachtext reduzieren. •UFO bietet personalisierte Nachhilfe in einer kleinen Lerngruppe: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen ihre eigenen Materialien mit zum Unterricht und stellen gezielte Fragen. • UFO trägt zu einer gelungen Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen bei. • UFO ist kostenfrei und hat wieder Plätze! • UFO – Anmeldung bei: Katrin Smeets, , 01520/1571776 Plakat -PDF- Zurück
Geplante Kappung des City-Rings löst Pendlerproblem nicht
Geplante Kappung des City-Rings löst Pendlerproblem nicht 19.11.2021 Die regionalen Wirtschaftsorganisationen city-marketing bonn e.V., DEHOGA Nordrhein e.V., Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen e.V., Handwerkskammer zu Köln, Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg e.V., Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg halten die erneute Kappung des City-Rings für den falschen Schritt. „Jahrzehntelange Versäumnisse im Bereich der Verkehrsinfrastruktur haben dazu geführt, dass Berufspendler in Bonn zweimal täglich erhebliche Staus verursachen“, sagt Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Bonn zählt jeden Tag 140.000 Einpendler aus der Region, während circa 60.000 Auspendler das Stadtgebiet verlassen. Hinzu kommen noch etwa 107.000 Binnenpendler, die sich innerhalb der Stadt zu ihrem Arbeitsort bewegen. Die dadurch verursachten Probleme – so die Wirtschaftsorganisationen – werden nicht gelöst, indem jetzt die Durchfahrt des City-Rings gekappt wird. Im Gegenteil, der Verkehr werde sich andere Routen suchen. Die Gefahr bestehe, dass andere Stadtteile durch negative Konsequenzen in Mitleidenschaft gezogen würden. Schon im Jahr 2019 formte sich die Bürgerinitiative für eine lebenswerte Südstadt, die auf die negativen Auswirkungen auf ihr Stadtviertel aufmerksam gemacht hat. „Die jetzt geplante Veränderung gefährdet zudem die Funktion des City-Rings, der der Stadt seit Jahrzehnten als stabiles Vehikel dient, den Verkehr durch die Stadt fließen zu lassen. Die Parkhäuser liegen bewusst rund um den Ring, damit Einkaufswillige sie mit dem Pkw gut erreichen können“, weiß Jannis Vassilliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes Bonn Rhein-Sieg Euskirchen e.V. Das wird in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein. „Von Süden kommend werden in der Regel die gut erreichbare Unigarage oder die Marktgarage angefahren. Bei voller Belegung der Garagen oder Staus ist der Besucher bei Kappung des City-Rings gezwungen, wieder Richtung Süden und durch eine Kehrtwende in Richtung Stadthaus zu fahren, um die anderen Parkgaragen zu erreichen“, teilt Karina Kröber, Vorsitzende city-marketing bonn e.V., mit. Kunden des Bonner Einzelhandels und vieler Gewerbetreibenden werden künftig große Umwege fahren müssen, um in die Stadt hineinzugelangen, bzw. die Parkhäuser im Innenstadtbereich anzufahren. Die Fahrzeuge der Handwerksbetriebe können oftmals die Tiefgaragen nicht nutzen, daher sind sie darauf angewiesen, oberirdisch möglichst nah am Auftraggeber zu parken. „Eine Unterbrechung des bisherigen Ringverkehrs erschwert dies und führt zu zusätzlichen Umwegen, was die Umweltbelastung erhöht“, sagt Garrelt Duin, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln. Schon jetzt gibt es Kunden, die die Bonner Innenstadt nicht mehr anfahren und auf gut erreichbare Handelsstandorte im Kreis ausweichen. Dieses Verhalten wird sich zum Schaden der durch die Corona-Pandemie ohnehin geschwächten Gewerbetreibenden in der Bonner Innenstadt auswirken. Möglicherweise kommt es wieder zu Kontakt beschränkenden Maßnahmen. Gerade jetzt benötigen die Betriebe optimale Bedingungen, wie zum Beispiel eine gute Erreichbarkeit und die Unterstützung durch Stadt und Verwaltung. Der Handel hat sich immer dort niedergelassen, wo Kunden eine leichte Zuwegung finden, die Handelswege sind auf diese Weise entstanden. „Zudem sind viele Händler und Gewerbetreibende auf regelmäßige Dienste von Handwerksunternehmen angewiesen. Auch diese müssen schnell und direkt zum Kunden kommen können“, ist sich Thomas Radermacher, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg, sicher. Der Einzelhandel in der Stadt muss langfristig stabilisiert werden, damit neue Chancen wahrgenommen und Innovationen eingeführt werden können. Weitere Frequenz- und Umsatzrückgänge hingegen dürfe es nicht geben. Aber auch Hotellerie und Gastronomie sind auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen. „Hotel- und Restaurantbesucher entscheiden nicht zuletzt mit Blick auf die Erreichbarkeit, wo sie übernachten bzw. essen möchten“, sagt Michael Schlößer von DEHOGA Nordrhein e.V. Wettbewerbsgleichheit sei hier von zentraler Bedeutung. Deshalb appellieren die sieben Wirtschaftsorganisationen als Vertreter der Unternehmen und der Gewerbetreibenden in der Bonner Innenstadt an die Ratskoalition, ihre angekündigte Entscheidung zu überdenken. „Um die angestrebte Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen, ist die Kappung des City-Rings schlicht und einfach überflüssig. Der City-Ring führt um eine der größten zusammenhängenden Fußgängerzonen in Deutschland. Eine große zusammenhängende autofreie Innenstadt existiert also bereits“, sagt Dirk Vianden, Vorsitzender von Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg. Stattdessen empfehlen die Wirtschaftsorganisationen, schnellstmöglich Alternativen zu entwickeln. Der ÖPNV muss ausgebaut und das Pendlerproblem durch Schaffung zusätzlicher Park & Ride-Anlagen im Umland gelöst werden, sodass Pkw-Fahrer die Möglichkeit zum Umstieg haben. Zudem müssen in der Innenstadt adäquate Abstellmöglichkeiten in ausreichender Anzahl für Fahrradnutzer geschaffen werden, damit auch die Potenziale des Fahrrads besser genutzt werden können. Hierin sehen die Unternehmen und Gewerbetreibenden wichtige Schritte zur Mobilitätswende, die dem Klimawandel entgegenwirken. Zurück
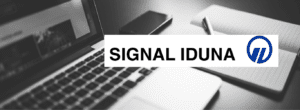
Sie fallen aus, wir springen ein. Ausfall des Inhabers oder Geschäftsführers.
Sie fallen aus, wir springen ein. Ausfall des Inhabers oder Geschäftsführers. Jedem Inhaber und Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes verschafft es schlaflose Nächte, wenn er an den eigenen langfristigen Ausfall denkt. Wer kümmert sich dann um meinen Betrieb? Ein langfristiger Ausfall kann gerade bei kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben nicht ohne Weiteres kompensiert werden. So kann es zu negativen Auswirkungen auf die Auftragslage, den Mitarbeitereinsatz und den Umsatz kommen. Auch bei optimalen betrieblichen Arbeitsabläufen und top motivierten Mitarbeitern gibt es Aufgaben, die eben nur der „Chef“ erledigen kann. Mit der neuen Inhaber-Ausfallversicherung der SIGNAL IDUNA sichern Inhaber oder Geschäftsführer von Handwerksbetrieben ihren krankheits- oder unfallbedingten Ausfall ab. So werden finanzielle Einbußen durch eine längere Arbeitsunfähigkeit aufgefangen. Die Leistung fließtdabei an den Betrieb und steht zur freien Verfügung. Unter anderem können weiterlaufende Kosten wie Miete, Gehälter und auch sonstige Verbindlichkeiten bezahlt werden. Die Beiträge sind als Betriebsausgaben anrechenbar. Natürlich könnte mit der Leistung aus der Inhaber-Ausfallversicherung auch eine fachkompetente und vertrauenswürdige Ersatzkraft finanziert werden. Die Leistung wird bereits bei einer Teil-AU von 60% Leistung fällig. Damit ist auch für den Fall vorgesorgt, dass man für den Einsatz vor Ort ausfällt aber noch anfallende Büroarbeiten ausüben kann. Für Innungsmitglieder hat SIGNAL IDUNA – als langjähriger Partner des Handwerks – auch hier wieder eine attraktive Zusatzleistung integriert. Buchen Sie sich in unserem Onlinekalender einen 30-minütigen telefonischen Beratungstermin oder eine Onlineberatung unter diesem Link: https://doodle.com/bp/si2017/inhaberausfall-durch-krankheit-oder-unfall—telefontermin